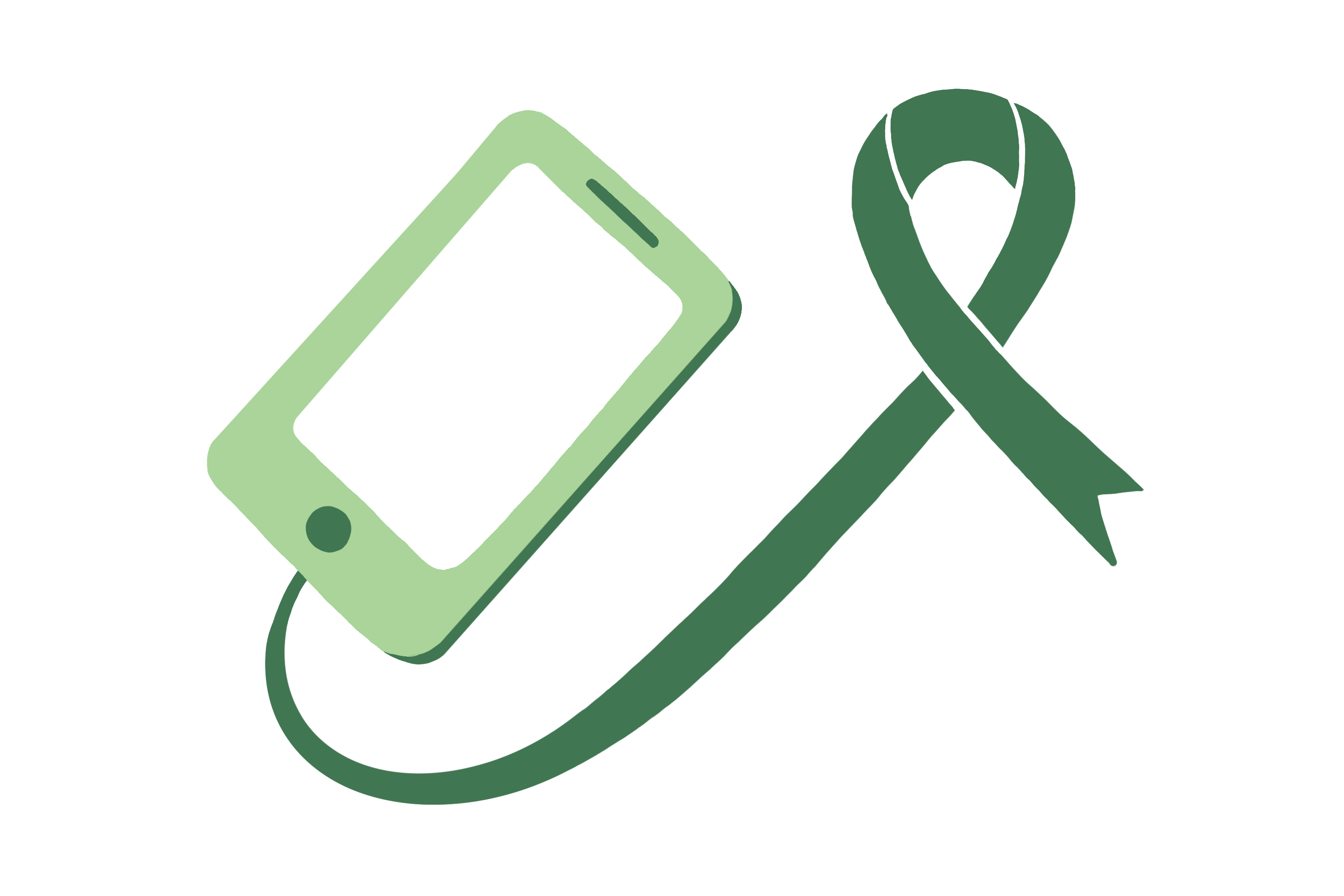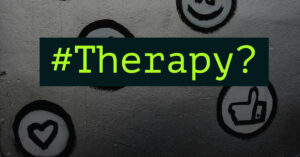Melancholische Musik, ästhetische Bilder in Schwarz-weiß-Tönen, traurige, schöne Gesichter und poetische Worte. Social Media eröffnet User:innen neue Wege, um über psychische Erkrankungen zu sprechen. Eine Möglichkeit, um über Krankheitsbilder aufzuklären und Stigmata abzubauen? Oder ein Social-Media-Trend, der User:innen zur Selbstinszenierung und Generierung von Klicks verhilft?
HINWEIS: In diesem Artikel werden sensible Inhalte, wie Suizidalität, Selbstverletzung und Essstörungen thematisiert.
Eine junge Frau blickt mit tränenverschwommenen Augen in die Kamera. „100 Gründe zu gehen“ ist auf englisch eingeblendet zu lesen. Es ertönen die Zeilen „But I’m holding on for dear life“ aus Sias Lied Chandelier. Der Videoclip dauert nur wenige Sekunden und doch ist die Botschaft der Erstellerin und TikTok-Userin Ahleena (@summertimesadnessfrfr) klar. Sie sieht 100 Gründe, weshalb sie nicht mehr weiterleben möchte. Das Video hat über 1 Millionen Aufrufe. Es ist nicht der einzige Clip auf dem Account der 16-Jährigen. In zahlreichen TikToks teilt sie anderen Nutzer:innen der Plattform mit, dass sie sich nie für gut genug hält und mit Vertrauensprobleme, Ängsten und Suizidgedanken kämpft. Wie für Ahleena ist auch für viele andere TikTok zu einer Plattform, um sich über ihre mentalen Probleme und psychische Erkrankungen mitzuteilen. Unter dem Hashtag #paintok finden sich zahlreiche Clips in den User:innen über ihre Erfahrungen mit depressiven Symptomen, Essstörungen oder Angsterkrankungen sprechen.
#paintok und Co. – Psychische Erkrankungen auf Social-Media-Plattformen
TikTok ist im Verlaufe der letzten zwei Pandemie-Jahre immer beliebter geworden und zählte im Sommer 2022 um die 1 Mrd. Nutzer:innen weltweit. Längst finden sich dort nicht mehr nur die kurzen Tanzvideos, die anfangs typisch für die Plattform waren. Von Rezeptinspirationen über Fantheorien zur neusten Netflix-Serie, bis hin zu Erziehungstipps für werdende Eltern, scheint es hier für jedes Interessengebiet auch Inhalte zu geben. Auch über psychische Erkrankungen spricht die Social-Media-Plattform und zwar nicht wenig. Der Hashtag #paintok hat über 4 Milliarden Aufrufe.
Auch auf anderen Social-Media-Plattformen, wie Instagram oder Twitter sprechen Nutzer:innen über psychische Erkrankungen. Lange war das ein Tabuthema in öffentlichen Diskussionen. An sich scheint das erstmal eine gute und fortschrittliche Entwicklung, dass psychische Erkrankungen auf Social-Media thematisiert werden. Vor allem wenn man bedenkt, dass es vor ein paar Jahren für die meisten Betroffenen schwer vorstellbar, sich öffentlich zu einer Depression oder Angststörung zu bekennen.

Die Tumblr-Ära: Sad-Girls, glamouröse Melancholie und Selbstverletzung
Psychische Erkrankungen werden nicht erst seit dem es TikTok gibt auf Social Media diskutiert. Die Microblogging-Plattform Tumblr war vor allem in den 2010er Jahren ein beliebter Ort für junge Menschen, um sich über alles mögliche auszutauschen – auch über psychische Probleme. In einem Artikel, der 2016 im Guardian erschienen ist, berichtet Mea Pearson, Tumblr Nutzerin und Borderline-Betroffene, wie die Plattform für sie zu einem Ort wurde, um sich mit anderen Betroffenen über ihre Erkrankung auszutauschen.
Im Gegensatz zu Plattformen wie Facebook, mussten User:innen auf Tumblr keine Klarnamen angeben. So konnten sie sich im Schutz der Anonymität offen über Persönliches sprechen und von anderen Zuspruch erhalten. Ein wenig wie ein Tagebuch, das antwortet. Während Menschen wie Mea Pearson Tumblr als Zufluchtsort nutzten und online versuchten dem Stigma um ihre Erkrankungen entgegenzuwirken, bot die Plattform auch Nährboden für gefährliche Communities und Bewegungen.
Ein Beispiel dafür ist die Pro-Ana-Bewegung, in welcher sich Nutzer:innen gegenseitig zu schädlichen Verhaltensweisen motivierten, um Gewicht zu verlieren. „Ana“ ist die Abkürzung für Anorexie. Pro-Ana-Accounts vertraten die Auffassung, Anorexie sei keine Erkrankung, sondern ein erstrebenswerter Lebensstil. Deshalb teilten sie Bilder von krankhaften dünnen Körpern unter dem Hashtag #thinspo (thin+inspiration) oder Zitate wie „skip the dinner, wake up thinner“. Unrealistische Körpervorstellungen, wie die „thigh gap“, eine Lücke zwischen den Oberschenkeln, ähnlich wie bei einer Barbie-Puppe, wurden polarisierten auf der Plattform. Autorin Ruby Staley erzählt Refinery29 im Februar 2022, sie sei durch die Beiträge auf Tumblr in eine Content-Spirale über Essstörungen geraten. Für ihr Teenager-Ich seien die Bilder von dünnen Körpern auf der Plattform damals zum Idealbild geworden, dem sie eifrig versucht habe nachzueifern.
Psychische Erkrankungen – Eine Social-Media-Ästhetik?
Die Pro-Ana Bewegung ist nicht das einzige Beispiel dafür, wie User:innen psychische Erkrankungen auf Tumblr romantisiert und glorifiziert haben. Die Medien-und Kommunikationsforscherin, Fredrika Thelandersson beschreibt in ihrem 2018 erschienen Essay Social Media Sad Girls and the Normalization of Sad States of Being einen Trend, an dem vor allem junge Frauen auf Tumblr teilgenommen haben. Die selbst ernannten „Sad Girls“ posteten und rebloggten Beiträge, in denen sie Depressionen, Selbstverletzung und Suizidalität künstlerisch anmutend ästhetisierten. „Among the sad girls on Tumblr, sadness and depression become normal rather than abnormal, to be sad and mad is something to strive for, it even becomes cool”, schreibt Theleandersson. Depressiv zu sein war unter diesen Sad-Girls cool und chic und gehörte quasi zum guten Ton auf Tumblr.
Inspiriert durch Elemente aus der Popkultur, wie Songtexte der amerikanischen Künstlerin Lana del Rey oder Seriencharakteren aus American Horror Story und Skins, kreierten Tumblr-User:innen eine Art von Ästhetik, die psychische Erkrankungen als schön und kunstvoll erscheinen ließ. Meist waren attraktive Menschen mit melancholischem Blick oder düstere Landschaften zu sehen. Auf der Plattform kursieren jedoch auch drastische Abbildungen von vernarbten Handgelenken, die offensichtlich durch eine Rasierklinge verursacht wurden.

Die “Sad-Girl-Theroy”
Die amerikanische Autorin Audrey Wollen hat zu Tumblr Hochzeiten mit ihrer Sad-Girl-Theory einen eigenen Beitrag zum Diskurs um die Darstellung psychischer Erkrankungen auf sozialen Medien geleistet. Für Wollen ist die Inszenierung von Traurigkeit und Depressionen der Sad-Girls eine Rebellion gegen patriarchale Unterdrückung. In einem Interview mit Nylon im Jahr 2015 erklärte sie: „Instead of trying to paint a gloss of positivity over girlhood, instead of forcing optimism and self-love down our throats, sticking a Band-Aid on this gaping wound, I think feminism should acknowledge that being a girl in this world is really hard, one of the hardest things there is, and that our sadness is actually a very appropriate and informed reaction. “

Wollens Sad-Girl-Theory wurde in feministischen Kreisen vermehrt aufgegriffen, so auch von von Johanna Hedva, amerikansiche:r Autor:in und Künstler:in. Hedva kritisierte an Audrey Wollens Sad-Girl-Theory vor allem, dass sie nicht inklusiv sei und lediglich die Erfahrungen weißer, hetero-cis Frauen aufgreife.
Vor allem von Psycholog:innen erntete Tumblr und die dort polarisierenden Beiträge über Selbstverletzung, Depression und Essstörungen auch viel Kritik. In einem Artikel des Undergraduate Research Journal of Psychology schreibt die Autorin Amina Shrestha, die Communites auf Tumblr wären gefährliche Echo-Kammern gewesen. Unter Echo-Kammern versteht die Wissenschaft soziale Räume, in denen die eigene Meinung von anderen geteilt und gespiegelt wird. Dadurch dass die Mitglieder einer Echo-Kammer mit anderen Ansichten nicht in Berührung kommen, verstärken sich ihre Meinungen automatisch. Shreshta meint, die Romantisierung von psychischen Erkrankungen auf Social-Media-Plattformen hätte außerdem dafür gesorgt, dass Krankheitsbilder von der Gesellschaft als banal oder sogar erstrebenswert wahrgenommen wurden. Das Leid von Betroffenen wurde dadurch nicht gesehen.
Viele, die in den 2010er Jahren aktiv auf Tumblr unterwegs waren, kritisieren diesen Communties und ihrer Art psychische Erkrankungen zu inszenieren heute ebenfalls.
Die Tumblr-Ära ist vorbei. Die Romantisierung von psychischen Erkrankungen auf Social Media damit auch?
Daniela Stelzmann, Kommunikationswissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FU Berlin forscht dazu, wie Menschen mit psychischen Problemen während der Corona-Pandemie nach Hilfe suchen. So ist sie auch mit Social-Media-Diskursen über psychische Erkrankungen vertraut.
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, die soziale Isolation und die Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens, haben begünstigt, dass auch über psychische Erkrankungen öffentlich mehr gesprochen wurde. Dazu sagt Stelzmann: „„Wir sehen in den Studien, dass das ‚kollektive Leiden‘ unter der Pandemie zum einen zu einer Entstigmatisierung geführt hat und die Menschen offener mit ihren psychischen Problemen umgegangen sind. Auf der anderen Seite zeigen aber auch Studien, dass für einen Teil der Betroffenen schwerer war, therapeutische Angebote in Anspruch zu nehmen, weil sie ihren eignen Leidensdruck nicht für relevant genug hielten oder das Gesundheitssystem nicht überlasten wollten.“
„Man bekommt oft den Eindruck als hätten alltägliche ‚Symptome‘ wie eine gedrückte Stimmung gleich auch eine psychopathologische Relevanz“
Wird psychisches Leiden auf sozialen Medien also eher über-pathologisiert statt entstigmatisiert? Oder wie Dr. Stan Kutcher, Psychologe und Professor an der Dalhousie University in Kanada es ausdrückt: „the pendulum has been swung from let nobody talk about it to let everybody blab about it“.
So pauschal lässt sich das nicht sagen, damit würde man vielen Menschen, die sich auf sozialen Medien mit ihrer Erkrankung outen, um anderen zu helfen, Unrecht tun, so Daniela Stelzmann. Als positives Beispiel nennt sie den deutschen Comedian Kurt Krömer, der mittlerweile sehr offen über seine Erfahrungen mit Depressionen spricht und versucht die Erkrankung mit all ihren Facetten greifbarer zu machen. „Auf der anderen Seite finden wir dann so eine Überkompensierung. Man bekommt oft den Eindruck als hätten alltägliche ‚Symptome‘ wie eine gedrückte Stimmung gleich auch eine psychopathologische Relevanz. Aber das muss nicht sein““, sagt Stelzmann.
„Menschen laufen Gefahr psychopathologische Krankheitsbilder zu banalisieren“
Pop-Psychologie, also psychologischer Themen, die für ein Laienpublikum aufbereitet werden, ist in vielen Kreisen sehr beliebt. Dieses allgemeine Interesse für Psychologie schlägt sich in der Art und Weise nieder, wie wir auf sozialen Medien und auch im realen Leben über psychische Erkrankungen sprechen. „Früher hat man gesagt: Mein Ex-Freund ist ein Idiot, heute sagt man er ist Narzisst. Heutzutage werden einfach viele Dinge psychologisiert oder gar psychopathologisiert“, führt Daniela Stelzmann als Beispiel auf. Das Problem hierbei sei vor allem, dass die Menschen Gefahr laufen psychopathologische Krankheitsbilder zu banalisieren und dadurch Betroffenen ihren Raum nehmen Gehör zu finden.
Vorsicht vor Fakenews
Auch in der Mental-Health-Community melden sich kritische Stimmen zu Wort. Die TikTok Userin @mal_to_the_b zeigt sich in ihren Videos besorgt darüber, wie ADHS auf TikTok dargestellt wird. Sie betont, dass ADHS keine liebenswerte kleine Macke sei, wie es viele TikToks-User:innen gerne darstellen würden, sondern eine ernstzunehmende Störung, die ihr Leben täglich erschwere. Die TikTok-Userin bezieht sich in ihrem Video auf eine Studie aus dem Jahr 2021, die sich mit der Verbreitung von falschen Informationen über ADHS auf TikTok befasst hat. Die Forschenden hatten sich dafür mit den 100 beliebtesten TikToks, über ADHS auseinandergesetzt und konnten feststellen, dass über die Hälfte der Inhalte, irreführende Informationen enthielten.
Zwar ist es grundsätzlich eine gute Entwicklung, dass man öffentlich mehr über Dinge spricht, die vor ein paar Jahren noch tabu waren, allerdings fehlt vielen Beiträgen auf Social Media ein notwendiger Kontext oder eine Einordung von psychologischer Seite. Im Interview mit der Los Angeles Times rät der Psychologe und Professor an der UCLA, John Piacentini, Social-Media-Nutzer:innen deshalb zu den Informationen, die sie auf sozialen Netzwerken über Krankheitsbildern finden, zusätzlich zu recherchieren. „Consider each person’s expertise and understand whether someone is giving advice based on personal experience or from a clinician’s point of view“, so Piacentini.
Kommunikation ist auch auf Social Media stigmabehaftet
Eine weitere Beobachtung Stelzmanns ist, dass Nutzer:innen auf sozialen Medien sehr selektiv über verschiedene Krankheitsbilder sprechen. Während die Öffentlichkeit über Depressionen mittlerweile weit offener diskutiert, findet man im Gegensatz dazu viel weniger zu Erkrankungen wie schizophrene Störungen oder Persönlichkeitsstörungen.
„Zu dem Zeitpunkt, wo wir vermehrt über das Thema Burn-Out gesprochen haben, war beispielsweise das Thema Depression noch sehr stigmabehaftet, weshalb man lieber den Begriff Burn-Out verwendet hat, weil das eben etwas hat von: Naja ich hab mich eben total aufgerieben an meinem Job, ich hab alles gegeben.“ Mittlerweile ist der Depressionsbegriff vielleicht weniger stigmatisiert, das Narrativ, das man es „trotz allem“ schafft, bleibt aber bestehen. Im Gegensatz dazu wird wenig über Medikation, stationäre Klinkaufenthalte und langwierige Therapieprozesse gesprochen, so Daniela Stelzmann.
„Ich denke man darf nicht vergessen, dass es auf Social Media ja auch um Klicks geht und natürlich um eine Form der Inszenierung.“
Man könne das zwar nicht pauschalisieren, so Stelzmann, aber in dem man sich verletzlich zeigt, generiere man auch Aufmerksamkeit. Das Bedürfnisse, sich nahbar und verletzlich auf Social Media zu zeigen, scheint auch mit einer Art Selbstinszenierung verbunden zu sein. Das spielt mit hinein, ob und wie Nutzer:innen online über psychische Erkrankungen sprechen.
Letztlich handelt es sich auch um sensible Themen. Hate Speech und Mobbing sind auf sozialen Netzwerken bekanntlich ein großes Problem. Das kann es Betroffenen schwer machen, sich frei zu Themen zu äußern, die öffentlich noch tabuisierter sind.
Was können soziale Medien zur Entstigmatisierung leisten?
Auf die Frage, ob die Kommunikation auf sozialen Medien generell zu unterkomplex ist, um über Themen wie psychische Erkrankungen zu sprechen antwortet Daniela Stelzmann: „Nein, das glaube ich nicht. Ich denke soziale Medien haben ein großes Potential Stigmata abzubauen, weil Menschen die Möglichkeit haben ihre Geschichte zu erzählen. Aber dadurch, dass das alles nicht reguliert wird, kann jeder irgendwas erzählen und es fehlt einfach oft eine Einordung. Am Ende ist es eben keine Psychoedukation, die dort stattfindet und die Botschaft, dass psychische Erkrankungen ernstzunehmende Erkrankungen sind, kann je nach Präsentation leider schnell in Vergessenheit geraten.“