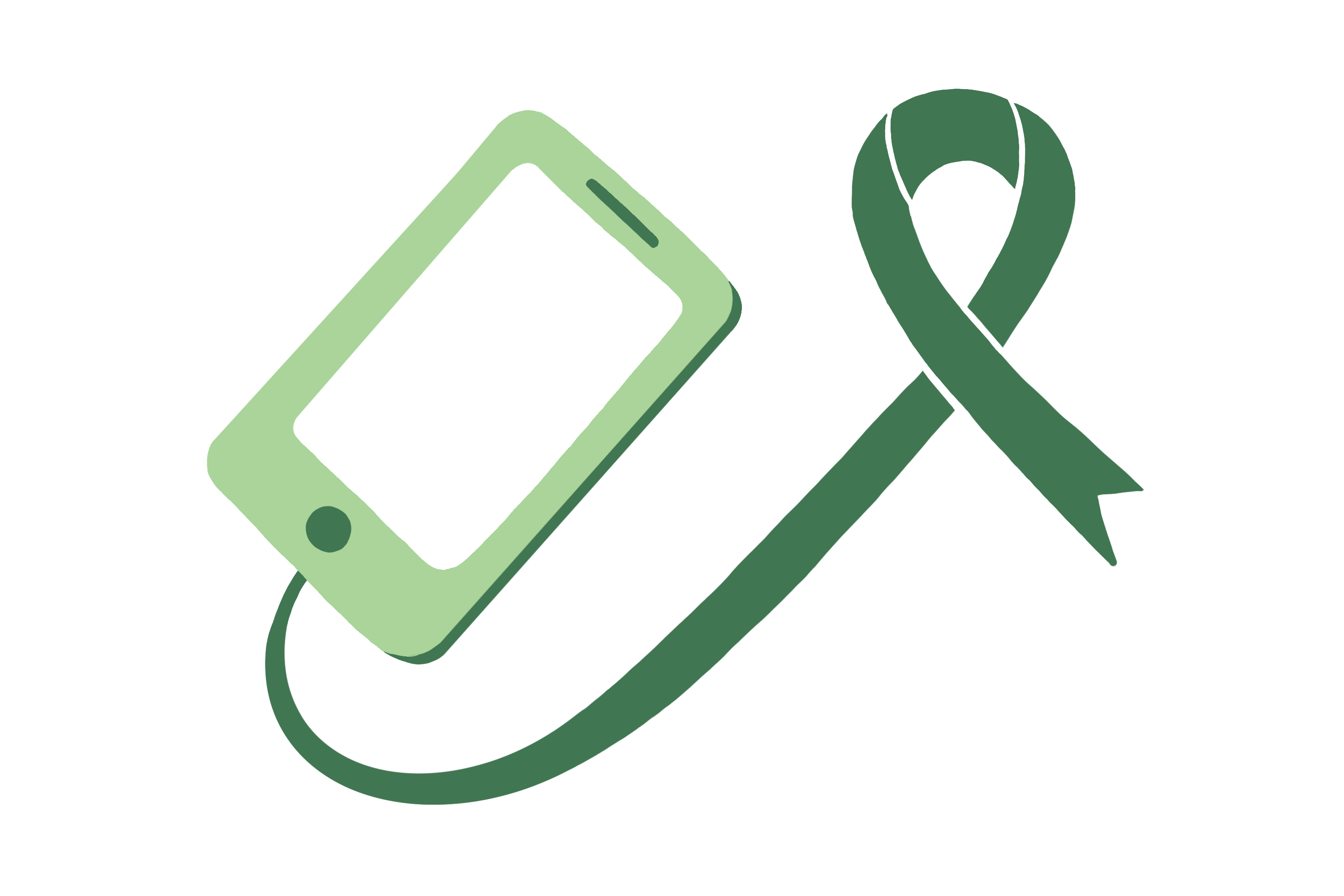Schlagzeilen über psychisch Kranke Verbrecher:innen dominieren die journalistische Berichterstattung über psychische Erkrankungen – das haben diverse Studienbefunde aus der Psychologie und Kommunikationswissenschaft gezeigt. Welche Erklärungen gibt es für diesen Fokus in der Berichterstattung? Hat sich an der Darstellungsweise in journalistischen Medien etwas verändert? Wie wirkt sich das auf das Stigma um psychische Erkrankungen aus?
Im September vergangenen Jahres sorgte der spektakuläre Ausbruch von vier Straftätern für Furore in der Medienberichterstattung. Die Geflüchteten waren aus einer offenen Station für psychisch – und suchtkranke Straftäter:innen in Weinsberg entkommen. Eine Geschichte, wie aus einem Hollywood-Film. Die BILD Zeitung schrieb vom Ausbruch aus einer „Psychiatrie für psychische gestörte Straftäter“. Bei Schlagzeilen wie diesen, könnte man sofort an wild gewordene Serienmörder, wie Michale Myers aus dem Horror-Klassiker „Halloween“ denken. Was in vielen Berichterstattungen jedoch unter den Tisch fiel, ist, dass drei der vier Insassen vor Abbruch der Therapie standen. Deshalb wären sie von der forensischen Psychiatrie ins Gefängnis verlegt worden. Auch blieb offen, ob das Risiko, das von den Flüchtigen ausging, tatsächlich im Zusammenhang mit ihrer psychischen Erkrankung stand.
Stigmatisierende Berichterstattung?
Schlagzeilen wie jene, über den Psychiatrie Ausbruch in Weinsberg, sind ein Beispiel dafür, weshalb Psycholog:innen und Mental-Health-Fürsprecher:innen dem Journalismus seit Jahren vorwerfen, einen großen Anteil am Stigma, um psychische Erkrankungen zu haben. Statistiken sowie Erkenntnisse der Psychologie zeigen, dass eine psychische Erkrankung allein kein Indikator für gewalttätiges Verhalten ist. Betroffene verüben auch nicht häufiger Straftaten, als jene ohne psychische Erkrankung. Wirft man jedoch einen Blick auf die journalistische Berichterstattung, erschließt sich ein anderes Bild. Denn Straftaten, die von psychisch Erkrankten verübt wurden, sind oftmals überproportional vertreten.
Die Nachrichtenberichterstattung über psychische Erkrankungen ist seit vielen Jahren Gegenstand kommunikationswissenschaftlicher und psychologischer Forschung. Forschende sehen hierin einen wesentlichen Faktor für das Stigma um psychische Erkrankungen. Der amerikanische Psychologe Otto Wahl schreibt dazu:
„Sensational stories about mentally ill killers perpetuate public fears and misconceptions related to mental illness. Those fears in turn fuel resistance to community care.“
Gewalttaten von psychisch kranken Straftäter:innen sind in der Berichterstattung überproportional vertreten
Matthias Angermeyer und Beate Schulz, Forschende am Lehrstuhl im Bereich Psychiatrie, publizierten in Jahr 2001 eine Studie zur Verbreitung von Stereotypen über psychische Erkrankungen in deutschen Boulevardzeitungen. Am Beispiel der BILD Zeitung konnten sie feststellen, dass über 50% der untersuchten Artikel über psychische Erkrankungen in Zusammenhang mit einem Verbrechen berichteten. Oft wurden diese Vorfälle genutzt, um über allgemeine Sicherheitsvorkehrungen oder vermeintliche Mängel in psychiatrischen Einrichtungen zu diskutieren. Nur 18,8% der Artikel lieferten Informationen über die Diagnostik und Behandlung psychischer Erkrankungen.
Auch aktuellere Studien zeigen, dass der Fokus auf Gewalttaten und Verbrechen im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen im Journalismus noch immer präsent ist. Aus den Ergebnissen einer Inhaltsanalyse dreier deutscher Zeitungen (Die Rheinpfalz, Frankfurter Allgemeine Zeitung und BILD) im Jahr 2018, ging hervor, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen besonders häufig als Täter:innen dargestellt werden. Gewalt und Verbrechen sind überproportional als Themenschwerpunkt der Artikel vertreten. Besonders oft wird außerdem über die Krankheitsbilder Schizophrenie und Depression berichtet. Die Schizophrenie taucht dabei meist im Zusammenhang mit Straftaten in der Berichterstattung auf. Depressive Störungen dagegen dienen oft als Aufhänger, um Missstände im Gesundheitswesen zu thematisieren.
Eine kanadische Studie hat gezeigt, dass sich die Berichterstattung über psychische Erkrankungen im Zeitraum von 2005 bis 2015 zwar verändert hat, immerhin werden Betroffene oder Expert:innen deutlich öfter zitiert und stigmatisierende Sprache weniger verwendet, das Thema Gewalt und Verbrechen steht jedoch noch immer stark im Fokus.
Negativität als Nachrichtenfaktor
In der Forschung zur Darstellung von psychischen Erkrankungen im Journalismus nehmen Expert:innen immer wieder Bezug auf die Nachrichtenwerttheorie. Diese geht mitunter auf die Arbeit der norwegischen Soziolog:innen Johan Galtung und Mari Homboe Ruge aus den 1960ern zurück. Nach den Annahmen der Nachrichtenwerttheorie sind bestimmte Faktoren ausschlaggebend dafür, ob Journalist:innen über ein Ereignis berichten. Diese Faktoren orientieren sich auch an den Interessen der Rezipient:innen, also dem, was Leser:innen einer Zeitung als relevant oder interessant empfinden. Aus diesen Faktoren lässt sich der Nachrichtenwert eines Ereignisses bestimmen. Beispiele für Nachrichtenfaktoren sind Aktualität, kulturelle oder geographische Nähe oder auch Negativität.
Forschende vermuten, dass der Faktor Negativität eine mögliche Erklärung dafür sein könnte, weshalb im Journalismus überproportional häufig über Gewalttaten, die von Menschen mit psychischen Erkrankungen verübt wurden, berichtetet wird. Negativen Ereignisse wecken demnach mehr Aufmerksamkeit und Interesse bei der Leserschaft. Ganz nach dem altbekannten Spruch: „If it bleeds it leads“. Die Kommunikationsforschende Abbey Evertt schreibt in ihrer 2015 erschienen Studie : „The existing medie coverage of mental illness seems to serve as an entertainment to the public, for example by mocking unusal behaviour or frequently covering rare but dramatic events.”
Führt negatives Framing zu stigmatisierenden Einstellungen?
Der amerikanische Soziologe William Gamson nahm an, dass der Nachrichtenwert eines Ereignisses außerdem dazu führen könne, dass Journalist:innen dieses auf eine bestimmte Art und Weise darzustellen versuchen, also diese zu framen. Der Framing Ansatz bezieht sich jedoch nicht nur darauf, wie Journalist:innen Nachrichten einbetten und darstellen. Sondern auch darauf, wie Rezipient:innen diese Frames übernehmen und in ihr Verständnis von Realität einfließen lassen.
Forschende, die sich mit der Wirkung von Medien auf Rezipient:innen befassen, haben versucht, den Einfluss von medialer Berichterstattung über psychische Erkrankungen auf stigmatisierende Einstellungen von Rezipient:innen zu ergründen. Eine Studie des Fachbereichs Psychologie am Illinois Institute of Technology hat im Jahr 2013 die Effekte von positiver, negativer und neutraler Berichterstattung auf das Stigma um psychische Erkrankungen untersucht. Dafür wurden Studienteilnehmer:innen in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe bekam einen Artikel zu lesen, der über erfolgreiche Therapieansätze in der Behandlung von Schizophrenie berichtete. Der zweiten Gruppe wurde ein Artikel präsentiert, der über den gewaltsamen Tod eines psychisch kranken Straftäters im Gefängnis berichtete. Der dritte Artikel wiederum hatte keinen Bezug zum Thema psychische Erkrankungen. Anschließend wurden alle Teilnehmenden befragt.
Die Ergebnisse zeigten, dass sich an der Annahme der Teilnehmer:innen, Betroffene seien für ihre Erkrankung selbst verantwortlich, auch durch die Konfrontation mit positiver Berichterstattung nicht viel veränderte. Jedoch konnten die Forschenden feststellen, dass Teilnehmende sich deutlich stärker für Sicherheitsmaßnehmen und gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen aussprachen und diese eher als gefährlich oder unberechenbar wahrnahmen, wenn sie den negativen Artikel zu lesen bekamen.
Anti-Stigma-Arbeit und Journalismus
Organisationen, die versuchen, dem Stigma, um psychische Erkrankungen öffentlich entgegenzuwirken, suchen seit einiger Zeit den direkten Kontakt zu Medienschaffenden. In Form von Schulungen, Workshops und Leitfäden sollen Journalist:innen für die Berichterstattung über psychische Erkrankungen sensibilisiert werden, um stereotype und stigmatisierende Darstellungen zu reduzieren. Ein verbreiteter Ratschlag für Journalist:innen ist beispielsweise, auf Anlaufstellen hinzuweisen, an die Betroffene sich in Notsituationen wenden können. In diesem Zuge diskutieren Medienschaffende, Psycholog:innen und Kommunikationswissenschaftler:innen auch über die Verantwortlichkeit von Journalist:innen.
Ist es Aufgabe des Journalismus Aufklärungsarbeit über psychische Erkrankungen zu leisten? Darüber scheiden sich die Geister.
Die Autor:innen der 2020 erschienen Studie „Psychische Erkrankungen in Medienberichterstattung“ schreiben in ihrem Fazit, es sie „nicht die zentrale Aufgabe journalistischer Medien, gegen Vorurteile und Diskriminierung vorzugehen“. Allerdings sei es ihre Aufgabe, über gesellschaftlich relevante Themen ausgewogen und korrekt zu berichten, verschiedene Perspektiven zu zeigen und keine Fehlinformationen zu verbreiten. Die Autor:innen fordern deshalb mehr Sensibilität gegenüber Betroffenen und eine korrektere, authentischere Darstellung von Krankheitsbildern. Wenn über Straftaten berichtet wird, sollten sich Journalist:innen demnach außerdem fragen, wie relevant die gestellte Diagnose für den eigentlichen Sachverhalt ist und ob diese in Zusammenhang mit der Tat steht, so die Autor:innen.