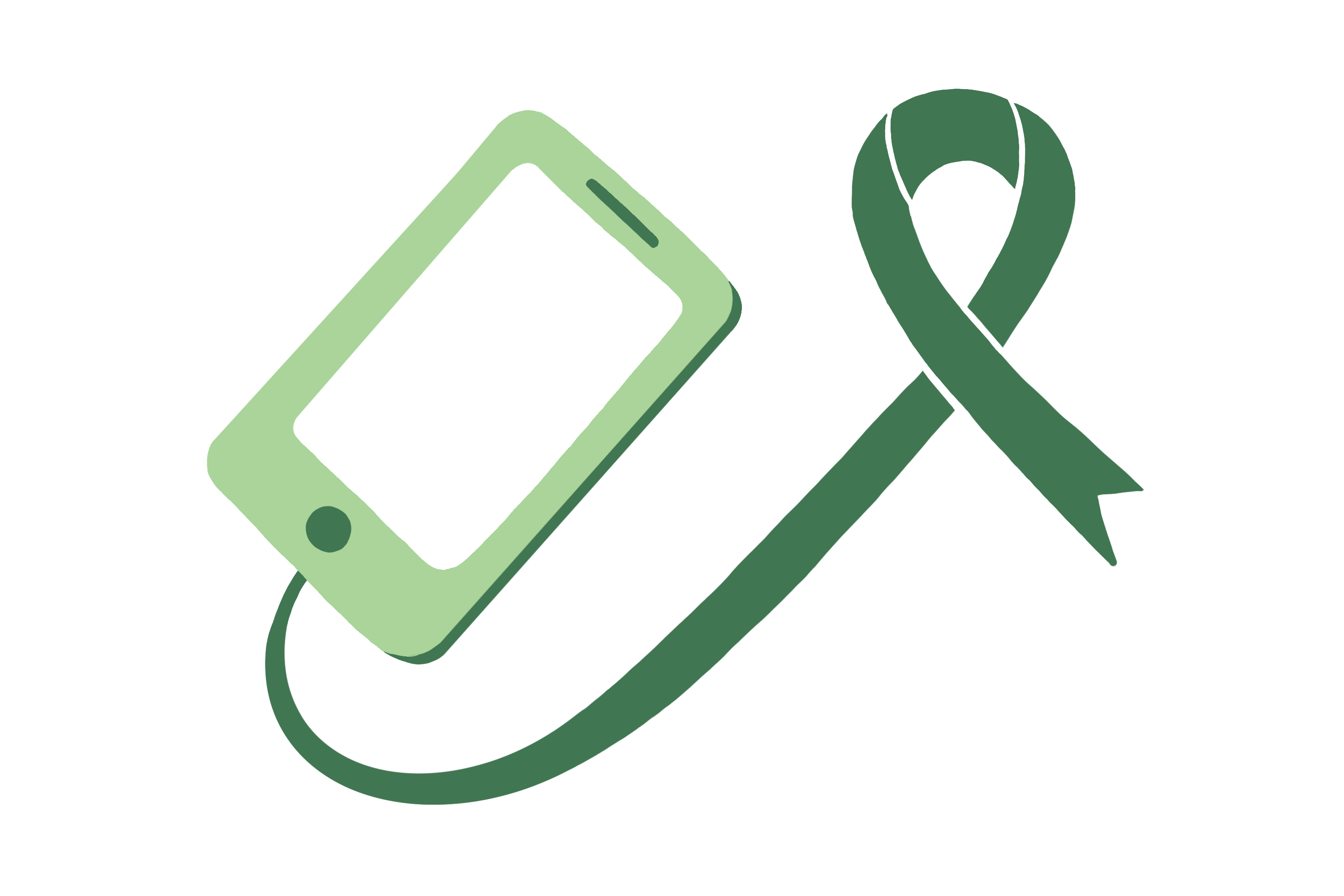Gefährliche Verrückte und wehrlose Versuchskaninchen. Die Darstellung von psychischen Erkrankungen in Filmen wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Vor allem aus den Reihen der Psychologie wurden in der Vergangenheit immer wieder Stimmen laut. Psycholog:innen warfen Filmen und Serien vor für das Stigma um psychische Erkrankungen verantwortlich zu sein. Laut dem amerikanische Psychologe Otto Wahl sind Filmen und Serien eine treibende Kraft, die das öffentliche Stigma um psychische Erkrankungen durch Stereotype und falsche Informationen aufrechterhalten. Filmwissenschaftlerin Melanie Mika gibt im Interview aus ihrer Forschungsperspektive einen Blick auf die Ergebnisse der Psychologie.
In ihrer Studie Homicidal Maniacs and Narcisstic Parasites konnten die Psychologen Hyler, Gabbard und Schneider im Jahr 1991 sechs Charakter-Stereotype identifizieren, die in Filmen häufig auftauchen, um Figuren mit psychischen Erkrankungen darzustellen. Der gewalttätige Verrückte, der rebellische Freigeist, das erleuchtete Mitglied der Gesellschaft, die weibliche Verführerin, der narzisstische Parasit und das Forschungsobjekt. Nach diesen Ergebnissen fällt die filmische Darstellung von psychisch Erkrankten außerdem meist wenig schmeichelhaft aus. Psychisch erkrankte Charaktere sind häufig gewalttätig, verrückt, unberechenbar, hilflos oder manipulativ. Wie haben sich diese Darstellungsformen im Laufe der Jahre entwickelt? Wie blickt die Filmwissenschaft auf die Forschungsergebnisse und die Vorwürfe der Psychologie?
Ein filmwissenschaftlicher Blick auf die 6 Charakter-Typen
Melanie Mika ist Filmwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Tübingen. Im Zuge ihrer Dissertation beschäftigt sie sich mit Seriencharakteren mit psychischen Erkrankungen. Mit Frau Mika werfe ich einen filmwissenschaftlichen Blick auf die Typisierung nach Hyler, Gabbard und Schneider. Außerdem gehen wir der Frage nach, was sich in der Film-und Serienlandschaft im Laufe der Jahre verändert hat und was Filme für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen leisten können.
Frau Mika, gehen wir diese Liste von Hyler, Gabbard und Schneider einmal durch. Da gibt es als ersten Typen den „Gewalttätigen Verrückten“. Was wäre ein Film-oder Serienbeispiel für diesen Charakter?
Melanie Mika: Da können Sie glaube ich ein ganzes Genre aufnehmen, nämlich ungefähr jeder Thriller oder Horrorfilm, in dem ein psychopathischer Mörder eine Rolle spielt. Es müssen auch nicht immer Horrorfilme sein, denn es gibt beispielsweise auch Tatort-Folgen, in denen dieser Charaktertyp verwendet wird. Der Charakter ist jemand vor dem man Angst hat, man weiß, dass er eine psychische Störung hat und er ist unkontrollierbar. Dieses Schema gibt es schon sehr lange, auch schon in Filmen aus den 30er und 40er Jahren. Die klassischen Hitchcock Filme würde ich allerdings dazu gar nicht zählen. Auch wenn es in Psycho einen Mörder gibt, der schon mehrere Frauen ermordet hat, fehlt ihm dieses brutale, das in diesem Charaktertyp stark drinsteckt.
Von Tatort bis Dexter – “Das Böse” erklären?
Sie haben gerade auch auf den Tatort hingewiesen. Also heißt das, dieser Trope nach wie vor auch in aktuellen Film-und Serienbeispielen verwendet wird?
Melanie Mika: Ja, das würde ich schon sagen. Natürlich gibt es da auch Abstufungen, da in einer Tatort-Folge nicht die Form an Gewaltexzessen gezeigt werden wie in einem Horrorfilm. Aber es ist trotzdem ein ähnlicher Charaktertyp, nämlich jemand, der unkontrolliert nacheinander eine Reihe an Menschen ermordet. In Kriminalserien, wie Dexter, kommt dieser Typ beispielsweise oft vor. Heute wird er aber häufig auch ironisch gebrochen, sodass man als Zuschauer:in weiß, dass es sich um eine stereotype Darstellung handelt, die nicht ganz ernst genommen werden kann.
Was ist meistens die Funktion dieses Charakters?
Melanie Mika: Der Charakter fungiert eigentlich immer als Antagonist, der das Böse verkörpert. Vor allem im klassischen Kino über die Jahrzehnte hinweg hat man als eine Art Backstory, die für die Geschichte eigentlich gar nicht wichtig ist, eine Erklärung gebraucht, warum jemand mordet. Eigentlich ist das Morden an sich schon das Spektakuläre, das man in einem Horrorfilm zeigen will. Damit das einigermaßen plausibel ist, hat der Charakter ein Kindheitstrauma oder eine psychopathische Störung und kann kein Mitgefühl empfinden.
Rebellische Freigeister – Psychische Erkrankung oder Selbstfindungphase?
Der nächste Typ ist der „rebellische Freigeist“. Was macht diesen Typ aus?
Melanie Mika: Unabhängig von psychischen Erkrankungen ist der rebellische Freigeist in Filmen und Serien ein Typ, der eine Art Gegenkultur bzw. Jugendkultur schafft. In Bezug auf psychische Erkrankungen finde ich es schwer dafür ein treffendes Beispiel zu finden.
Ich habe in Zusammenhang mit diesem Typ oft den Hauptcharakter Randle McMurphy aus Einer flog über das Kuckucksnest gesehen. Finden Sie er passt in dieses Schema?
Melanie Mika: Ja stimmt, das passt hier ganz gut. Wobei man hier auch sagen muss: der Film spielt in der Psychiatrie und der Charakter ist eigentlich gar nicht psychisch krank, sondern spielt das nur vor, um dem Gefängnis zu entkommen. Er ist also jemand, der das System austrickst und die Figur, mit der wir Sympathie haben, obwohl er sich nicht konform verhält. Ansonsten muss ich hier an alles, was mit Jugendserien zu tun hat, denken. Ich finde es aber häufig schwer zu identifizieren, ob eine jugendliche Selbstfindungsphase, eine depressive Phase oder eine Art von nicht angepasst sein, dargestellt werden soll.
Systemkritik im Film?
Würden Sie dann sagen, dieser Charakter übt Systemkritik , in dem er sich Regeln widersetzt?
Melanie Mika: Das kann natürlich Kritik sein, aber es hat gleichzeitig auch etwas Romantisierendes und Stigmatisierendes. Zum einen wird romantisiert, dass sich jemand nur Selbst finden muss und sich eine psychische Erkrankung verwächst, indem man sich selbst kennenlernt und seine Träume verwirklicht. Stigmatisierend sind die Darstellungen in dem Sinne, dass psychiatrische Institutionen oft dämonisiert werden. Das wurde auch bei Einer flog über das Kuckucksnest sehr kritisiert. Zwar kann man an diesen Institutionen auch Dinge kritisieren, aber so menschenverachtend sind die Behandlungen natürlich nicht. Die Institution wird dann auch in dem Sinne dämonisiert, dass unterstellt wird sie nimmt dem Menschen durch Behandlung seine Originalität weg (siehe dazu auch: Von Dr. Evils und Dr. Wonderfuls -Psychotherapie im Film, ein kultureller Mythos?).

Genies in anderen Sphären
Der nächste Typ in der Liste ist das „erleuchtete Mitglied der der Gesellschaft“. Inwiefern unterscheidet sich dieser Charakter vom „rebellischen Freigeist“?
Melanie Mika: Ich glaube unter diesem Charakter kann man viele Subtypen fassen. Zum einen gibt es diese Künstlerfiguren, die in einer anderen Sphäre sind, sich nicht ganz normal verhalten und anders ticken. Da sie aber Künstler sind dürfen sie das und verstehen mehr über die Gesellschaft und die Welt. Das ist dann auch wieder sehr romantisierend, weil dadurch vermittelt wird, dass es für diese Art von Selbstausdruck nötig wäre regelmäßig depressive Phasen zu haben und man daraus seine Inspiration zieht.
Das ist glaube ich ein gefährliches Narrativ, dass sehr viel unterschwelliger wirken kann als der Serienkiller. Der Serienkiller ist zwar brutal auf eine Art, die psychische Kranke meistens nicht sind und sie daher stigmatisiert. Dieses romantisierende Narrativ, dass man sein Selbst und seine Kreativität aus der Erkrankung schöpft, kann aber auch sehr gefährlich sein, denn es suggeriert: „Ich lasse mich besser nicht behandeln, sonst verliere ich meine besondere Gabe“.
Die psychische Erkrankung als “Gabe”
Melanie Mika: Was denke ich auch in diesen Typ hineinzählt und eher eine neure Entwicklung ist, sind Serien- und Filmfiguren, die Expert:innen auf ihrem Gebiet sind. Zwar nicht auf künstlerischer Ebene, aber sie verstehen auf die gleiche Art mehr über die Gesellschaft. Beispiele dafür sind Carrie Mathison aus Homeland oder Elliot Alderson in Mr. Robot, die extrem gute Agenten oder Hacker sind und verstehen, wie eine Finanzwirtschaft funktioniert oder wie Terroristen agieren. Grund dafür ist, dass sie psychische Krankheiten haben und deshalb anders denken und sich darin hineinversetzen können. Diese Charaktere haben ihre Krankheit genutzt und sind Expert:innen auf ihrem Gebiet.

Therapie in Serien – erfolgreich bis zu einem gewissen Grad?
Sieht man diese Charaktere dann auch erfolgreich zur Therapie gehen und spielen Heilungsprozesse eine Rolle?
Melanie Mika: In Serien ist es sehr selten, dass die Figuren erfolgreich therapiert werden. Wobei hier auch die Serienlogik eine Rolle spielt und nicht nur die Erzähllogik, da man meist eine weitere Staffel haben möchte. Wenn die Grundvoraussetzung für die Handlung eine bipolare Agentin oder ein schizoider Hacker ist, dann mach ich mir mein Grundnarrativ kaputt, wenn der am Ende erfolgreich mit der Therapie ist und diese Probleme nicht mehr hat.
Man sieht vor allem diese neueren Figuren schon regelmäßig in Therapie. Es ist aber häufig so, dass sie diese dann abbrechen, weil es ihnen nichts nützt. In Homeland sagt Carrie beispielsweise oft, dass ihre Medikamente sie vernebeln würden. Die Medikamente sind bis zu einem gewissen Maße gut, wenn es sich aber wirklich zuspitzt, müsse sie diese absetzen, damit sie einen klaren Kopf bekommt. Um dieses „Genie“ zu erhalten, muss die Therapie abgebrochen werden, denn der Geniegedanke verträgt sich meist nicht so gut mit Therapie in diesen Formaten.
Geschlechterstereotype und psychische Erkrankungen im Film
Dann kommen wir zum nächsten Typ, nämlich der weiblichen Patientin als Verführerin. Was sind Charaktere, die ihnen dazu einfallen?
Melanie Mika: Ich würde sagen jeder zweite Hitchcock Film. Da gibt es ganz viele klassische Beispiele, wie Marnie oder Spellbound. Die Charaktere verführen manchmal bewusst, wie in Spellbound, manchmal aber auch indirekt. Die Frau ist hier natürlich schuld, dass die Männer ein Verhältnis mit ihr beginnen, weil sie so faszinierend ist und sie ihr erliegen. Der Mann muss erst wieder zu Verstand kommen, um sie zu heilen. Es muss sich nicht immer um diese negativ konnotierte Femme fatal handeln, die die Männer um sich herum zu Grunde richtet, sondern kann auch eine sympathische Figur sein. Aber das eine psychisch kranke Frau auch immer mit Sexualität verbunden wird, die irgendwie unterdrückt und gestört ist, ist sehr häufig der Fall.

Die “weibliche Verführerin” – ein Produkt des male gaze
Welche Erkrankungen haben weiblichen Figuren meistens , wenn es denn so deutlich gesagt wird?
Melanie Mika: Bei diesem Typus fallen mir mit die meisten klassischen Stereotype ein. Ich glaube das hat schon viel mit Genderdarstellungen zu tun, was dazu beigetragen hat, dass Frauen sehr stereotypisch gezeigt werden. Frauen haben in der Regel Depressionen und Angststörungen. Diese beiden Sachen sind es häufig und dann kommen gerne noch irgendwelche Traumata dazu, die sich manchmal in Zwangsstörungen und Ängsten ausdrücken. In Hitchcocks Marnie hat die weibliche Figur Angst vor der Farbe Rot, weil sie ein Kindheitstrauma damit verbindet. Aber meistens ist es so, dass Frauen depressiv und ängstlich sind. Bis in die 50, 60er Jahre gab es auch dieses Bild von Hysterie.
Also sind diese Figuren eine Art Produkt des male gaze?
Melanie Mika: Ja genau. Beziehungsweise ist der Begriff male gaze filmspezifisch und eine Art, wie man die Werke analysieren würde. Generell hat das auch mit einer Gesellschaft zu tun, die Frauen über viele Jahrzehnte hinweg sehr stereotyp gesehen hat. Ich glaube, dass man das gar nicht nur so eng in einem filmischen Blick sehen kann, sondern dass sich das auch gesellschaftlich deckt und in anderen Medien zu finden ist.
Stadt-Neurotiker, die ihre Neurosen “pflegen”
In der Typologisierung gibt es auch noch den „narzisstischen Parasit“, was kann man sich denn unter diesem Charakter vorstellen?
Melanie Mika: Das würde ich eher mit Komödien verbinden, zum Beispiel mit Woody Allen Filmen. Die spielen in der gehobenen Mittelschicht irgendwo in der Stadt und wir sehen Charaktere, die sich ein Stück weit darin suhlen zur Therapie zu gehen, besonders zu sein und nicht normal arbeiten zu können. Das ist zum einen ein häufiges Vorurteil gegenüber psychischen Krankheiten und es wird filmisch auch so inszeniert, dass wir als Zuschauende drauf gucken und dahinter sehen können, dass dieser Charakter eigentlich gar nichts hat. Woody Allen spielt sich in der Regel selbst in der Rolle des so genannten „Stadt-Neurotikers“, der das Privileg hat, sich in seinen Gedanken so zu ergehen.
Da spielt also auch das Narrativ mit hinein, dass sich die Leute die Erkrankung selbst aussuchen würden?
Melanie Mika: Genau, und auch das man sagt, durch die Therapie pflegen sie die Erkrankung mehr, als dass sie sich um Heilung bemühen würden.
Schock und Faszination beim Publikum
Der letzte Typ den Hyler, Gabbard und Schneider nennen, ist das „Forschungsobjekt“. Was macht diesen Typ aus?
Melanie Mika: Da muss ich zum Beispiel an den zweiten Film von Dr. Mabuse denken und generell an Filme, die relativ alt sind. Bei Dr. Caligari ist das zum Beispiel auch der Fall. Das verbindet sich gerne auch mit dem bösen Psychiater, der psychisch auch nicht ganz normal zu sein scheint. Man hat hier Patienten, die man benutzt und als Forschungsobjekte vorführt. In dem zweiten Dr. Mabuse gibt es zum Beispiel Szenen, in der er das anhand einer Diashow in einer Vorlesung vorführt und aus heutiger Sicht ganz abstruse Theorien über das Gehirn hat, nämlich das da buchstäblich etwas verrückt wäre. Oder, dass mit Hypnosen Leute manipuliert werden und man fasziniert ist, was sie dann machen.
Irgendwie ist bei diesen Filmen immer auch schon klar, dass die Psychiater die Bösen sind und die Patienten als sehr hilflos dargestellt werden, aber eben auch als sehr wenig menschlich. Sie werden vorgeführt, ähnlich wie im Zirkus, als Monster. Teilweise sind sie auch gefährlich, teilweise aber auch total willenlos und haben sehr wenige menschliche Züge.
Ist die Typisierung heute noch relevant in der Forschung?
Nutzen Sie die Typisierung von psychisch kranken Charakteren, auch in der Filmwissenschaft? Denn die Studie selbst kommt ja aus dem Bericht der Psychologie?
Melanie Mika: Ich nutze sie für meine eigene Arbeit nicht, das liegt aber vor allem auch daran, dass ich mich stark für ästhetische Aspekte interessiere. Bei Studien aus den 80er und 90er Jahren ist es ganz häufig so, dass sie sich auf den Inhalt fokussieren. Welche Figur ist das? Mit welchem Genre haben wir es hier zu tun? Und dort bleiben die Studien oft stehen. Das ist zwar ein guter Startpunkt gewesen, aber in der Medien- und vor allem Filmwissenschaft mittlerweile überholt, da man sich auch anschaut, wie und mit welchen filmischen Techniken etwas dargestellt wird.
Werden die Darstellungen komplexer?
Hat sich die Liste mit diesen Typisierungen dann in diesem Zuge erweitert?
Melanie Mika: Ich glaube das hat sich in zwei Richtungen verändert. Zum einen ist nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern auch die Darstellung von psychischen Krankheiten sehr viel feiner geworden. Ich glaube es gibt viele Darstellungen, wo diese Stereotype nicht mehr so schematisch auf Figuren passen. Dadurch wurden diese Typisierungen ein wenig aufgeweicht und es gibt vieles, was dazwischen liegt und man nicht mehr genau sagen kann: „das ist jetzt Typ 3 oder Typ 4“. Zum anderen sind viele Anti-Helden-Figuren dazugekommen, die zwar Hauptfiguren sind, moralisch aber nicht so eindeutig eingeordnet werden können. Diese Figuren sind vor allem in den letzten 20 Jahren entstanden und gelten in Serien auch als Qualitätsmerkmal für Komplexität.
Welche Erkrankungen werden gezeigt?
Was können Sie beobachten, welche Krankheitsbilder werden in Serien und Filmen denn besonders häufig aufgegriffen? Und gibt es je nach Krankheitsbilder Unterschiede darin, wie sich die Charaktere typisieren lassen?
Melanie Mika: Ich glaube das Krankheitsbild hängt schon sehr stark damit zusammen, welcher Charaktertypus gezeigt wird. Es gibt nach wie vor sehr viele Serienkiller in Filmen und Serien, denen irgendeine psychische Krankheit nachgesagt wird. Was meiner Meinung nach am häufigsten gezeigt wird ist zum einen eine Form von Psychopathie, die emotionslos, reuelos und ganz kaltblütig berechnend agiert, aber weniger in Horrorfilmen, oder wo es sehr blutrünstig zugeht, auftaucht. Schizophrenie als Oberbegriff ist ebenfalls sehr häufig vertreten. Das ist auch in der Wirklichkeit eine sehr komplexe Krankheit, die beispielsweise Halluzinationen und dissoziative Phasen hervorrufen kann. In Filmen wird das häufig als Persönlichkeitsspaltung dargestellt.
Traumata im Film
Melanie Mika: Auch wenn das zwar nicht per se eine psychische Krankheit ist, haben Traumata auch über die Jahrzehnte ganz viel Konjunktur, weil man damit eine Krankheitsgeschichte, eine Backstory oder ein Verhalten sehr schön zeigen kann. Das wird dann meist als Belastungsstörung gezeigt, welche zu Zwangshandlungen oder Angststörungen führt.
Ja das ist schon sehr auffällig. Gerade in den neuen Superheldenfilmen, wird viel auf ein zurückliegendes Kindheitstrauma zurückgedeutet.
Melanie Mika: Ja, das könnte man der Typologie vielleicht auch hinzufügen. Das gab es zwar früher auch schon, es hat aber sehr zugenommen, dass jede antagonistische Figur irgendwo ein Kindheitstrauma offenbart, genauso wie der Protagonist, der sich dem dann stellen muss.
Filme und Gesellschaft – Eine Wechselwirkungsbeziehung
Inwieweit sind aktuelle gesellschaftliche Probleme und Diskurse mit der Entstehung solcher Figuren verknüpft?
Melanie Mika: Ganz allgemein gesagt würde ich sagen, es gibt immer eine Wechselwirkung zwischen einer Gesellschaft und dem, was wir medial, filmisch oder künstlerisch darstellen. Ich glaube auch, dass die Darstellung von Trauma zum einen zugenommen hat, weil wir das Bedürfnis haben uns Dinge erklären zu können, zum anderen weil die Sensibilität dafür, dass es so etwas gibt, zugenommen hat. Generell glaube ich, dass wir sehr viel sensibler für psychische Erkrankungen geworden sind und das deshalb sehr viel nuancierter sehen.
Was man auch beobachten kann, ist, dass Therapien auch ganz anders dargestellt werden. Die Psychoanalyse hat man in den 50er, 60er und 70er Jahren viel gesehen, da das damals auch in der Wirklichkeit eine sehr gängige Methode war. Das nimmt nun aus verschiedenen Gründen ab und sieht man viel weniger, dafür aber andere Methoden, wie medikamentöse Behandlungen. Die Behandlungen werden generell sehr viel realistischer gezeigt, man hat nicht mehr die Psychiater, die entfernt ihr Diagnoseobjekt beobachten, sondern sieht viel mehr Gespräche und Menschlichkeit.
Diversität in der Darstellungsweise
Wie divers ist die Medienlandschaft denn hier? Gibt es Repräsentation von Charakteren mit psychischen Erkrankungen, die nicht weiß und/oder queer sind?
Melanie Mika: Die Studienlage zeigt, dass es da nicht sehr divers ist. Es wäre natürlich sehr wünschenswert, dass das anders ist. Zum einen haben wir generell zu wenig Diversität in Film-und Fernsehen, die meisten Hauptfiguren sind weiß und häufiger männlich als weiblich. Von denen hat nur ein kleiner Teil psychische Krankheiten. Es gibt wenig Identifikationsfläche für Menschen, die nicht weiß sind oder eine andere Geschlechtsidentität haben und im Zusammenhang mit psychischen Krankheiten nochmal weniger.
Es gibt natürlich auch auf der Produktionsebene sehr wenige Regisseurinnen oder Kamerafrauen, die POC sind und das schlägt sich auch in den Geschichten nieder, die erzählt werden. Wenn man es positiv ausdrücken möchte könnte man sagen, dass es gut ist, dass eine Sensibilität dafür gibt, dass so etwas auch mit Betroffenen abgesprochen werden muss und man daher auch POC braucht, die selbst Filme machen und diese Geschichten angemessen darstellen können. Es ist auch angemessen, dass sich ein Tom Tykwer nicht in der Position sieht zu erzählen, wie sich beispielsweise ein Transfrau mit Depressionen fühlt. Hier gibt es einfach zu wenig Diversität auf Seiten der Produktion.
Was jedoch als Negativbeispiel genannt werden kann, ist, dass es durchaus queere Charaktere mit psychischen Erkrankungen gibt, die dann aber sehr stigmatisiert werden. Das Schweigen der Lämmer wurde dafür zurecht sehr als transphob kritisiert. Der Antagonist, Buffalo Bill wird hier immer als Mann bezeichnet, der eine Frau sein möchte und nicht als Transfrau. Der Charakter wird auch deshalb zum Serienkiller, weil er sich aus der Haut von anderen Menschen eine neue erschaffen möchte, da er sich selbst in seiner Haut nicht wohl fühlt.
Spannungsfeld Filmwissenschaft und Psychologie
Filmwissenschaftler:innen sprechen oft davon, dass es in Filmen weniger darum geht Krankheitsbilder medizinisch richtig zu zeigen, sondern sie im Kontext sozialer und gesellschaftlicher Diskurse zu betrachten. Darstellungen von psychischen Krankheiten müssten deshalb immer im Entstehungskontext des Films gesehen werden müssen. Hans Wulff schreibt dazu auch, dass die Vielfältigkeit von Erzählweisen verloren gehen würde, wenn wir psychisch kranke Charaktere in Filmen nur im Hinblick auf medizinische Korrektheit betrachten. Ergibt sich hier ein Spannungsfeld zwischen Psychologie und Filmwissenschaft?
Melanie Mika: Dieses Spannungsfeld zwischen Film bzw. Kunst und Psychologie gibt es auf jeden Fall, zumindest auf akademischer Ebene. Man kann sich nicht richtig verständigen und erwartet verschiedene Dinge von Filmen, beziehungsweise sieht dort unterschiedliche Sachen. Als Filmwissenschaftlerin würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass es in Filmen nicht nur um eine medizinische Richtigkeit geht.
Es ist nur eine Möglichkeit etwas sehr realistisch darzustellen. Man kann etwas aber auch künstlerisch verfremden. Die Krankheit kann metaphorisch für etwas anderes stehen, ich kann aber auch beispielsweise ein Trauma auf eine Art und Weise darstellen, die nicht realistisch ist, weil ich eine Metapher dafür finde. Realistisch wäre es vielleicht, dass die Figur sich zurückzieht und nicht mehr reagiert. Das ergibt dann wahrscheinlich aber nicht unbedingt einen guten Film und, dass man dafür eine andere Darstellungsform findet, ist auch das, was Kunst macht und total okay.
“Nicht jeder Film muss aufklären”
Melanie Mika: Ich würde Hans Wulff in dem Sinne nicht zustimmen, dass ich Angst hätte eine medizinische Korrektheit würde die Filmform schmäleren. Ich würde speziell eher sagen, dass man von Seiten der Medizin nicht verwechseln darf, dass medizinisch korrekt gleichbedeutend mit einem pädagogischen Anspruch ist. Nicht jeder Film muss aufklären. Nicht jeder Film muss eine Krankheit so darstellen, dass die Leute, die ihn sehen genau wissen, wie sie vorgehen würden, wenn sie darunter leiden würde. Filme müssen auch nicht immer Hoffnung machen, dass Therapie etwas nützt. Nicht jeder Film ist ein Aufklärungsfilm, der diesen Zweck hat. Wenn man Geschichten nur zum Zweck der Aufklärung schreiben würde, dann geht etwas verloren.
Aber auch eine sensible und korrekte Darstellung schmälert nicht die Form, in der man etwas erzählen kann und psychische Krankheiten sind nun mal einfach sehr vielseitig. Wenn manche Stereotype, wie zum Beispiel die Genderstereotype wegfallen, würde ich das auch nicht als großen Verlust sehen. Ich denke man muss unterscheiden zwischen Aufklärungsfilmen und einer angemessenen, sensiblen Darstellungsweise.
Publikumswirkung- wie nehmen Zuschauer:innen die Darstellungen war?
Sind diese metaphorischen Bedeutungen für ein breites Publikum zugänglich? Oder sieht die Mehrheit der Zuschauer:innen lediglich das negative Bild von psychischen Erkrankungen ohne es auf tiefere Bedeutungen zu hinterfragen?
Melanie Mika: Ich glaube bei Blockbustern oder Filmen, die das sehr plakativ machen, ist die Gefahr von einer Stigmatisierung schon sehr hoch. Da müsste man aber auch gucken, ob der Film eine tiefere Bedeutung hat, oder ob es nur ein Stereotyp ist. Generell wäre ich optimistisch, weil wir eine recht hohe Medienkompetenz im Bereich von fiktionalen Formaten haben, da wir alle mittlerweile sehr viel Seherfahrung mit Filmen und Serien haben. Deshalb habe ich den Eindruck, dass sehr viele Menschen recht viel Metaphorisches an Filmen verstehen. Wenn Menschen über Filme reden, tun sie das doch sehr nuanciert.
Denken Sie bei älteren Filmen wären Hinweise sinnvoll, die das Publikum darüber informieren in welchem gesellschaftlichen Kontext die Darstellung von psychischer Krankheit entstanden ist?
Melanie Mika: Ich finde das eine spannende Idee. Ich glaube in ganzer Breite ist das nicht für jeden Film machbar. Wenn man ältere Filme, wenn sie beispielsweise auf Festivals gezeigt werden oder bei einem Themenabend im Fernsehen laufen, in einen Kontext setzt, finde ich das sehr sinnvoll. Ich denke es wäre wichtig, dass das spezifisch auf den Film und die Situation, die man erklären will, zugeschnitten ist. Was ich nicht für sinnvoll halten würde, wären generische Hinweise, wie Warnungen für Zigaretten. Ich denke so etwas könnte eher zur Abstumpfung führen.
Gibt es positive Entwicklungen?
Würden Sie sagen, es lassen sich positive Entwicklungen darüber beobachten, wie wir psychische Erkrankungen in Filmen und Serien verstehen?
Melanie Mika: Eine positive Entwicklung ist, dass vieles nuancierter und komplexer wird. Es gibt auch mehr ambivalente Figuren, die nicht nur böse oder nur gut sind. Ich glaube das trägt dazu bei, dass es normalisiert wird, dass Figuren, die nicht in einem Psychiatriekontext gezeigt werden, auch psychisch krank werden können und trotzdem eine Familie und einen Job haben können. Bei sehr stereotypen Darstellungen in der Vergangenheit kam das häufig zu kurz und die einzige Aufgabe einer depressiven oder schizophrenen Figur war es krank zu sein. Auch wenn nicht alles medizinisch korrekt ist sieht man trotzdem öfter, dass eine Figur verschiedene Aspekte hat, und das würde ich positiv sehen. Was ich aber nicht sagen kann, ist, ob das gesellschaftlich auch überall ankommt oder ob das nicht innerhalb einer bestimmten Blase bleibt. Aber die Darstellung ist auf jeden Fall auf einem richtigen Weg.
Wie viel Authentizität kann man erwarten?
Wir haben gerade auch schon darüber gesprochen, dass Unterhaltungsmedien den medizinischen Vorstellungen wahrscheinlich gar nicht 1:1 gerecht werden können. Welchen Platz würden sie diesen Inhalten dann im Prozess der Entstigmatisierung zuschreiben?
Melanie Mika: Ich glaube was wichtiger ist als 1:1 die richtigen Symptome oder Behandlungsmöglichkeiten zu zeigen, ist ,dass Unterhaltungsmedien normalisieren können und man Figuren sieht, die komplex sind und neben ihrer psychischen Erkrankung auch andere Funktionen für die Geschichte haben. Zum Beispiel, dass sie in einer Familie funktionieren können, einen Job haben, dies und jenes erreicht haben und das eine Schizophrenie kein Ausschlusskriterium dafür ist.
Daran schließt meine Abschlussfrage gut an. Was sollten sich Medienschaffende/ Filmemacher:innen fragen, wenn sie Charaktere mit psychischen Erkrankungen darstellen möchten? Was denken Sie, wie Filme und Serien den Spagat zwischen Entstigmatisierung und künstlerischer Mehrdeutigkeit schaffen können?
Melanie Mika: Ich glaube, man muss auf jeden Fall mit Betroffenen zusammenarbeiten. Das wird teilweise auch schon gemacht. Ich denke was Filmemacher:innen sich auf jeden Fall fragen müssen, ist, ob sie genug Wissen haben, um sich in diese Perspektive hineinzuversetzen und ob sie das nicht nur als Metapher oder Backgroundstory verwenden wollen. Ich denke das wäre die Ausgangsposition dafür, um angemessene Darstellungen schaffen zu können. Was häufig zu kurz kommt, ist auch einmal den Blick zu wenden und sich zu fragen: Wie sehen Betroffene das eigentlich? Menschen, die mit einer Angststörung, einer Depression oder einer Schizophrenie diagnostiziert sind, gucken auch alle Filme. Wie sieht das aus deren Perspektive aus?