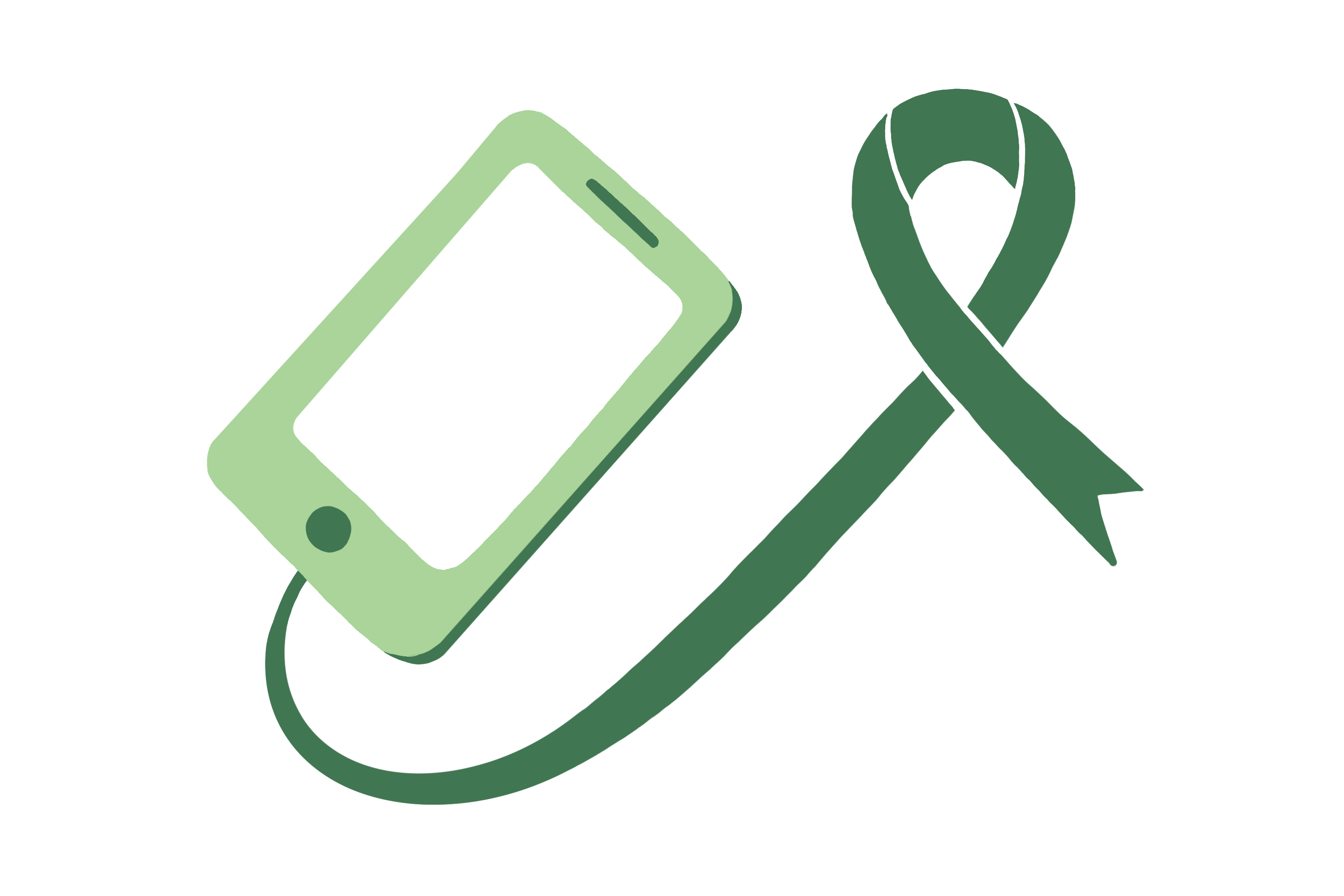Gender, Race und Class- alles irrelevant, wenn es um psychische Erkrankungen geht? Schließlich kann jede:r betroffen sein, oder etwa nicht? Aber wer kommt im medialen Diskurs um psychische Erkrankungen zu Wort? Welche Stimmen sind in journalistischen Formaten vertreten und welche Rolle spielen gesellschaftliche Privilegien für die Stigmatisierung von Betroffenen? Eine Suche nach Diversität in der journalistischen Medienlandschaft.
Wie geht’s dir? Mit dieser Frage eröffnet Miriam Davoudvandi fast jedes ihrer Interviews im Cosmo-Podcast Danke Gut. „Danke Gut“ – damit beantwortet so manch einer die Frage nach dem persönlichen Wohlbefinden. Der Realität entspricht das sicherlich nicht immer. In ihrem Podcast über Pop & Psyche will Miriam Davoudvandi die Floskeln deshalb beiseitelassen. Sie möchte einen Raum schaffen, in dem offen und ehrlich über Gefühle gesprochen wird. Damit will sie negative Gefühle und psychische Erkrankungen entstigmatisieren und über Themen sprechen, die in der Medienlandschaft bislang zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Mit ihren Interviewpartner:innen spricht Miriam Davoudvandi über Krankheitsbilder, wie Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Angsterkrankungen, Schizophrenie, Sucht und vieles mehr. Ihre Gäste haben durch verschiedene Migrationsgeschichten, Krankheitserfahrungen und das Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind, ganz unterschiedliche Perspektiven, die sie in ein Interview mit hineinbringen.
Prominent und psychisch krank – Bekannte Gesichter teilen ihre Erfahrungen
Zu den Podcast-Gästen zählen viele bekannte Gesichter aus der deutschen Medienlandschaft. Dazu gehören unter anderem Musiker:innen oder YouTuber:innen. Dagi Bee, Henning May, Casper und Nadja Benaissa von den No-Angels, sind nur ein Auszug der Prominenz, die schon mit Miriam Davoudvandi über ihre Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen gesprochen hat. Auch Psycholog:innen sind regelmäßig zu Gast und sogar die ein oder anderen Politiker:innen haben sich schon die Ehre gegeben.
Promis, die über ihre Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen sprechen. Das gibt es in der Medienlandschaft nicht erst seit Miriam Davoudvandis Podcast. Ein aktuelles Beispiel ist der deutsche Comedian Kurt Krömer. Sein 2022 erschienenes Buch Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, in welchem er offen über seine Depression, Alkoholsucht und seine Therapie in einer Tagesklinik spricht, hat es sogar auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Im Danke Gut Podcast, war Kurt Krömer ebenfalls schon zu Gast.

©Kiepenheuer&Witsch
Auch internationale Berühmtheiten haben sich in der Vergangenheit immer wieder zu ihren psychischen Erkrankungen geäußert. Dazu gehören zum Beispiel Künstler:innen wie Lady Gaga, Selena Gomez, Demi Lovato, Ariana Grande und Elton John. Auch der Bestseller Autor John Green und Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio, haben sich öffentlich zu einer psychischen Erkrankung bekannt.
Der Diana-Effekt
Menschen mit einer derartigen öffentlichen Präsenz können viel dazu beitragen psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren. Amanda Calhoun und Jessica Gold, forschen im Bereich Psychiatrie an der Universität Yale und an der Universität Washington. In ihrem 2020 erschienen Artikel stellen sie die These auf, Prominente könnten ihren Fans vermitteln, dass psychische Erkrankungen kein Tabu sind. So hätten sie außerdem die Möglichkeit Betroffene dazu zu ermutigen, sich entsprechende Hilfe zu suchen. Die Autorinnen beziehen sich in diesem Zusammenhang auf den „Diana-Effekt“, benannt nach der verstorbenen britischen Prinzessin Diana. Diese sprach 1993 öffentlich über ihren Erfahrungen mit einer Essstörung und polarisierte damit in internationalen Medien. Nach dem Auftritt der Prinzessin konnten Forschende feststellen, dass die Anzahl an Frauen, die sich therapeutische Hilfe wegen einer Essstörung suchten, deutlich anstieg. Calhoun und Gold sehen in prominenten Repräsentant:innen deshalb eine wichtige und effektive Möglichkeit psychische Erkrankungen öffentlich und medial zu entstigmatisieren.

©Wikimedia Commons
Eine psychische Erkrankung kann jede:n treffen. Auch erfolgreiche Menschen, mit einem scheinbar perfekten Leben. Diese Botschaft vermitteln Medienformate, in denen Prominente über ihre psychische Erkrankung sprechen, oft. Damit wirken sie dem stigmatisierenden Narrativ entgegen, Menschen mit einer psychischen Erkrankung seien fundamental anders als der Rest der Gesellschaft.
Selbstoptimierung und Erfolg als Messlatte für psychische Gesundheit
Das Narrativ „Es-trotz allem-geschafft-zu-haben“ birgt jedoch auch Problematiken. Gaston Franssen, Professor für Literatur und Intermedialität an der Universität Amsterdam, setzt sich in einem 2020 erschienen Essay mit Demi Lovatos öffentlichen Umgang mit einer bipolaren Störung auseinander. Fransson kritisierte, dass Lovato immer wieder davon spricht, Therapieerfolge nur durch harte Arbeit erreicht zu haben und, dass man sich konstant selbst optimieren müsse, um die beste Version seiner selbst zu werden.
Doch ab wann ist man überhaupt die beste Version seiner selbst und ist diese Selbstoptimierung notwendig für den Therapieprozess einer psychischen Erkrankung? Franssen erkennt darin ein neo-liberales Narrativ, wonach Individuen die alleinige Verantwortung für ihre mentale Gesundheit tragen. Psychische Gesundheit ist dabei eng mit persönlichem Erfolg verknüpft. „Schafft“ es eine Person nicht, die eigene psychische Verfassung konstant zu verbessern, gleicht das dem persönlichen Versagen.
Eine Frage des Privilegs?
Für Franssen ist diese konstante Selbstoptimierung der Ausdruck einer leistungsorientierten, kapitalistischen Gesellschaft. Prominente Personen wie Demi Lovato befinden sich jedoch auch in einer privilegierten Position. Sie verfügen über genügend Ressourcen, um die bestmögliche therapeutische Hilfe zu bekommen. Zudem sind sie finanziell abgesichert und können sich eine längere berufliche Auszeit erlauben. Wenn Therapieerfolge so stark an persönliche Leistung gekoppelt werden, könnten weniger privilegierte Betroffene Schuld und Scham dafür empfinden, dass sie scheinbar einfach nicht hart genug für ihr psychisches Wohlbefinden arbeiten, so schreibt Fransson.
Kurt Krömer setzt sich mit seiner privilegierten Position als Prominenter auseinander. In seinem Buch Du darfst nicht alles glauben, was du denkst spricht er offen darüber, therapeutische Hilfe in einer privaten Klinik in Anspruch genommen zu haben. Ihm sei bewusst, dass er im Gegensatz zu vielen anderen durch finanzielle Mittel schneller die richtige Hilfe bekommen habe. Auch, dass das ein prinzipielles Problem im deutschen Gesundheitssystem sei, thematisiert Krömer. Monatelange Wartelisten bei Therapeut:innen, sind für Betroffene auf der Suche nach Hilfe keine Seltenheit. Viele können sich keine private finanzierte Therapie leisten und sind daher auf einen kassenfinanzierten Platz angewiesen.
Mediales White-Washing im Mental-Health Diskurs
Psychische Erkrankungen betreffen Menschen jeden Geschlechts, jeder ethnischen und religiösen Zugehörigkeit, jeder sexuellen Orientierung und jeder gesellschaftlichen Schicht. Im medialen Diskurs werden jedoch vor allem weiße Stimmen gehört. Das Media Diversity Institute, ein internationaler Zusammenschluss, der sich für diversere Berichterstattung in den Medien einsetzt, hat dazu 2020 einen Artikel veröffentlicht. Schwarze Menschen und People of Colour mit einer psychischen Erkrankung kommen demnach in Medieninhalten deutlich seltener zu Wort als betroffene weiße Personen. Dabei werden psychische Erkrankungen durch Faktoren wie Rassismus-Erfahrungen und Diskriminierung nachweislich sogar begünstigt. Die Autorin des Artikels spricht deshalb auch von einem „medialen White-Washing“.
Stigma, psychische Erkrankungen und Intersektionalität
Verschiedene Forschende haben außerdem darauf hingewiesen, dass auch das Stigma um psychische Erkrankungen intersektional ist. So auch Dalon Taylor und Donna Richards, die Autorinnen eines 2019 im Frontiers of Sociology erschienen Artikels, der sich mit den Erfahrungen psychisch kranker Schwarzer Frauen mit karibischen Wurzeln in Kanada befasst.
Das Konzept der Intersektionalität bezieht sich darauf, dass verschiedene Formen von Unterdrückung und Diskriminierung gleichzeitig existieren und sich gegenseitig bedingen können. Die Autorinnen der Studie appellieren, dass auch das Stigma um psychische Erkrankungen durch die Linse der Intersektionalität betrachtet werden müsse. Eine Schwarze Frau mit einer psychischen Erkrankung ist im Gegensatz zu einem ebenfalls psychisch kranken, aber weißen Mann, immer mit Rassismus und Sexismus konfrontiert. Das schlägt sich auch darin nieder, wie sie Stigmatisierung wegen ihrer psychischen Erkrankung erfährt.
Die Autorinnen des Artikels schreiben außerdem, dass Schwarzen Menschen, insbesondere Schwarze Frauen ihre psychische Erkrankung oft auf Grund rassistischer Vorurteile abgesprochen werde.
„Additionally, for Black (Caribbean) women, who are faced with the dominant construct of being „superwoman “, unfeminine, controlling, and independent, characteristics linking them to men, they are inclined to deny the existence of symptoms of depression”
So schreiben Taylor und Richards. Auch dass viele Therapeut:innen zu wenig über die Traumata, die Rassismuserfahrungen bei Betroffenen hinterlassen, wissen, sei ein strukturelles Problem, dass es Betroffenen erschwere, die richtige Therapie und Hilfe zu finden.
Cultural Sensitivity im medialen Diskurs um psychische Erkrankungen
Werden Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen größtenteils durch die Linse eines weißen und westlichen Wertesystems betrachtet, gehen die Perspektiven und die Erfahrungen vieler Betroffener im öffentlichen Diskurs verloren. Davon schreiben auch die Journalistinnen Linda Ocasio und Karen Weintraub in ihrem 2014 erschienen Artikel, im Sammelband The Massachusetts General Hospital Textbook on Diversity and Cultural Sensitivity in Mental Health. Cultural Sensitivity – oder auf Deutsch interkulturelle Sensibilisierung – bedeutet anzuerkennen, dass verschiedene kultureller Werte, die Ansichten und das Verhalten einer Person prägen und mitbestimmen. Die kulturellen Werte, mit denen jemand aufgewachsen ist und sozialisiert wurde, spielen deshalb auch eine Rolle dafür, ob und wie Betroffene nach Hilfe suchen und wie sie Stigmata verinnerlichen.
Das zeigt auch ein Interview des Formats Jetzt der Süddeutschen Zeitung, indem junge Frauen mit osteuropäischen Wurzeln von ihren Erfahrungen mit Essstörungen erzählen. Die Betroffenen sprechen darüber, wie kulturelle Werte der Herkunftsländer ihrer Eltern sie in ihrer Erkrankung geprägt haben. „In Polen ist das Schönheitsideal für Frauen noch viel ärger“, meint eine Betroffene im Artikel beispielsweise dazu.
Durch Stereotype in Medieninhalten gehen viel Erfahrungen unter
Mit verschiedenen psychischen Erkrankungen identifiziert man häufig auch bestimmte Stereotype. Betroffene einer Essstörung wie Anorexia Nervosa oder Bulimie sind meist weiblich, jung und extrem dünn – zumindest ist das die gängige Vorstellung, wie sie auch von Filmen wie To the bone oder der britischen Serie Skins transportiert wird. Um die Kriterien einer Essstörung zu erfüllen, müssen Betroffene allerdings nicht in dieses Raster hineinpassen. Ein Artikel des australischen Nachrichtendienstes ABC News schreibt dazu:
„Not everyone is young, thin, white or a woman“.
Betroffene werden medial jedoch häufig mit diesen stereotypen Vorstellungen konfrontiert. Nicole McDermid, Betroffene einer Essstörung erzählt im Artikel davon, dass sie oft gedacht habe, ein bestimmtes Gewicht erreichen zu müssen, um mit ihrer Erkrankung ernst genommen zu werden.
Bulimie und Anorexie sind bei weitem nicht die einzigen Krankheitsbilder, die zu den Essstörungen zählen. Auch Binge-Eating ist eine Essstörung, über die medial jedoch nur wenig gesprochen wird. Eine Studie der Soziologinnen Abigail Saguy und Kjerstin Gruys aus dem Jahr 2010, hat sich mit der Darstellung von Essstörungen in der Nachrichtenberichterstattung befasst. Die Autorinnen konnten dabei feststellen, dass journalistische Artikel, die sich mit Anorexie oder Bulimie befassen, Betroffene häufig als Opfer ihrer Erkrankung darstellen. Betroffene einer Binge-Eating-Störung, werden dagegen selbst für Essanfälle oder Übergewicht verantwortlich gemacht. Anorexie und Bulimie Betroffene gelten zudem als zielorientiert. Ihnen wird ein hohes Maß an Selbstkontrolle zugeschrieben. Beides sind positiv konnotierte Eigenschaften. Übergewicht oder Essanfälle, wie sie Teil der Symptomatik einer Binge-Eating-Störung sind, gelten dagegen als ein Zeichen für Faulheit, mangelnde Selbstbeherrschung und als persönliches Versagen der Betroffenen.
Diversität von Erfahrungen sichtbar machen
Einen diverseren Diskurs von psychischen Erkrankungen, einen intersektionalen Blick auf Stigmata und ein Bewusstsein dafür, dass es für Menschen, die ohnehin schon zu einer marginalisierten Gruppe gehören, zusätzliche Hürden gibt, wenn sie therapeutische Hilfe benötigen – das wünschen sich viele der hier genannten Autor:innen und Betroffenen. Psychische Erkrankungen und ihre Behandlung existieren nach diesen Beobachtungen und Erfahrungen nämlich nicht in einem gesellschaftlichen Vakuum, in dem Privilegien einfach verschwinden.
Formate wie Miriam Davoudvandis Podcast Danke Gut oder auch Artikel wie der 2021 in der Zeit erschienen „Wir sind zur Therapie“, in dem mehr als 30 verschiedene Menschen von ihren Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen und Therapie sprechen, sind Beispiele dafür wie, der medialen Diskurs diverser gestaltet und Repräsentation für eine Bandbreite verschiedener Erfahrungen geschaffen werden kann. Denn psychische Erkrankungen sind, wie diese Erfahrungsberichte deutlich zeigen, in allen Ecken der Gesellschaft präsent.