Wie kann journalistische Berichterstattung dazu beitragen, Tabu-Themen, um psychische Erkrankungen aus dem Verborgenen zu holen? Mit Burkhard Ciupka-Schön, praktizierender Psychotherapeut mit Schwerpunkt auf Zwängen, spreche ich darüber, wie Medieninhalten diesen Themen gerecht werden können, weshalb Medienarbeit auch für Therapeut:innen und Betroffene wichtig ist und darüber, was er sich von Journalist:innen in der Berichterstattung wünscht, um Tabus zu brechen.
Erklärung vorab – Was ist eine Zwangserkrankung/OCD:
Betroffene einer Zwangserkrankung, oder auf englisch Obsessive Compulsive Disorder (OCD), leiden an wiederkehrenden Gedanken, Impulsen und Vorstellungen, die aufdringlichen Charakter haben und Unbehagen und Angst hervorrufen. Bemühungen, diese Gedanken zu unterdrücken, bleiben erfolglos und steigern oft sogar ihre Stärke (Quelle: Deutsche Gesellschaft für Zwangserkrankungen). Diese aufdringlichen Gedanken sind egodyston. Das heißt, sie sind entgegen dem, was Betroffene als Teil ihres Selbst und ihres Wertesystems empfinden. Betroffene entwickeln in diesem Zuge Handlungen und Rituale, um den quälenden Charakter dieser aufdringlichen Gedanken zu mildern, sogenannte Zwangshandlungen. Dabei kann es sich um sichtbare, physische Handlungen handeln, wie Waschen, oder Kontrollieren. Jedoch gehören auch mentale Rituale, wie zwanghaftes Grübeln, Eigen- und Fremdrückversicherung oder mentales Überprüfen mit dazu.
Das Themenspektrum dieser Zwangsgedanken ist sehr breit. Zu den verbreiteten aufdringlichen Gedanken gehören beispielsweise, die Angst Mitmenschen Schaden zufügen zu wollen und aufdringliche aggressive und sexuelle Gedanken. Auch die Befürchtungen eine körperliche Erkrankung zu haben, Ängste sich durch verunreinigte Gegenstände kontaminiert zu werden, gehören zu den häufigen Zwangs-Themen. Ebenso die Angst eigentlich pädophile Neigungen haben, die Angst den/die Partner:in nicht aufrichtig zu lieben und zahlreiche mehr. (Quelle: OCDLand)

©Instagram @ocdland
Die Zwangshandlungen, die Betroffene ausführen, um diese quälenden Gedanken zu lindern, verstärken diese jedoch tatsächlich. Deshalb sind die Gedanken nicht das eigentliche Problem der Erkrankung, sondern die extremen Reaktionen der Betroffenen darauf. Zwangserkrankungen werden in der Kognitiven Verhaltenstherapie aus diesem Grund nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen effektiv mit Exposition mit Reaktionsverhinderung behandelt (Quelle: OCDLand). Dabei setzen sich Betroffene bewusst angstauslösenden Situationen und Gedanken aus, ohne ihre darauffolgenden Handlungen und Rituale durchzuführen.
Die Zwangsstörung – Ein Tabuthema?
In vielen Kreisen und Bereichen der Gesellschaft sind psychische Erkrankungen noch immer ein Tabu-Thema, über das wenig gesprochen wird. Das führt dazu, dass innerhalb der Bevölkerung große Wissenslücken über viele Krankheitsbilder vorhanden sind. Betroffene halten sich oft im Verborgenen. Viele wissen selbst nicht, dass ihre Symptome Teil eines behandelbaren Krankheitsbildes sind und suchen deshalb auch nicht nach therapeutischer Hilfe. Ein Beispiel hierfür sind Betroffene einer Zwangserkrankung. Geschätzt suchen 2/3 der Betroffenen keine professionelle Hilfe auf. Im Durchschnitt vergehen bis zu 6 Jahre, bis Zwangserkrankte sich das erste Mal in Kontakt mit Psychotherapeut:innen begeben. Das liegt mit auch daran, dass öffentlich wenig darüber gesprochen wird, was Zwangserkrankungen eigentlich sind. Wie kann journalistische Berichterstattung dazu beitragen, Tabu-Themen, um psychische Erkrankungen aus dem Verborgenen zu holen?
Herr Ciupka-Schön, erzählen Sie mir zu Anfang doch etwas über sich und ihren Werdegang. Wie sind Sie zu ihrem Schwerpunkt Zwänge gekommen?
Ciupka-Schön: Burkhard Ciupka-Schön ist mein Name. Ich bin 59 Jahre alt, habe jetzt mein dreißigstes Berufsjubiläum gefeiert und die meiste Zeit meiner Berufstätigkeit, habe ich mich bislang mit Zwangsstörungen beschäftigt. 1995 war ich einer der Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Zwangserkrankungen, wo wir sowohl Unterstützung und Gründung von Selbsthilfegruppen betrieben als auch die wissenschaftliche Fachöffentlichkeit zu Forschung im Bereich Zwangsstörung motiviert haben. Wir haben in erster Linie Betroffene in Selbsthilfegruppen vermittelt und niedergelassene Therapeuten im ambulanten Bereich und Kliniken, die sich auf Zwangsstörungen spezialisiert waren, vermittelt. Weil auch immer wieder Journalisten angerufen haben, von Printmedien, von TV und vom Rundfunk, bin ich in diesen fünf Jahren auch immer wieder journalistisch tätig gewesen.
Journalistische Formate für Aufklärungsarbeit nutzen
Wie sahen diese journalistischen Tätigkeiten damals aus und was war ihre Motivation dahinter?
Ciupka-Schön: Wir haben erstaunlich viel journalistisch gearbeitet. Das heißt, wir haben eine Vereinszeitschrift rausgegeben, die vierteljährlich erschienen ist, zu allen möglichen Themen rund um die Zwangserkrankung. Betroffene sind da zu Wort gekommen, neue Forschungsansätze wurden vorgestellt, Kliniken haben sich dort vorgestellt und ich habe auch selbst immer wieder kleine Artikel veröffentlicht, über Themen, mit denen ich auch über das Beratungstelefon in Berührung gekommen bin. Ich bin auch immer wieder in Interviews mit den Medien Print, Funk und Fernsehen aktiv gewesen, zum Beispiel in Livesendungen und Talkshows. Meistens war es dafür erforderlich, sogenannte Originaltöne von Betroffenen mitzubringen, das heißt, es mussten auch immer Betroffene selbst mit dabei sein. Nur allein ein Experte in einer Talkshow, das wäre nicht gegangen und deswegen war es immer die Kombination: Ein Experte begleitet eine Betroffene, die dann vor großem Publikum über das Thema Zwangserkrankung berichtet.
Medienarbeit holt Betroffene aus ihrem Schattendasein
Und ihr Ansporn war es, das Thema bekannter zu machen und mehr Menschen, die selbst betroffen sind, zu erreichen?
Ciupka-Schön: Ja, ganz genau! Ich glaube, einer der Anstöße für die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Zwangserkrankungen im Jahr 1995 war eine aktuelle wissenschaftliche Erkenntnis, und zwar, dass die Zwangserkrankung viel häufiger war, als man bis dahin angenommen hatte. Damals ging man so von 1,5% aus, mittlerweile geht man sogar von 4% Zwangserkrankten in der Bevölkerung aus, während man in allen Veröffentlichungen Zwänge für ein seltenes Randphänomen gehalten hat. Zwangserkrankte, das muss man vorab sagen, neigen dazu im Verborgenen zu leben. Man kann auch sagen: „Zwänge, das ist die versteckte Erkrankung“. Deshalb stellte sich schnell heraus, dass gerade Medienarbeit, eigentlich eine eher unübliche Arbeit für Psychologen, das Mittel der ersten Wahl ist, um die Betroffenen aus ihrem Schattendasein zu holen und sie zu motivieren, sich Hilfe zu suchen. Denn ganz allein, ohne professionelle Hilfe geht das in den meisten Fällen leider nicht.
OCDLand – Aufklärung und Unterstützung für Betroffene
Seit einiger Zeit sind Sie aktiv bei OCDLand. Was genau ist das für eine Plattform, wie sind Sie dazu gekommen und welche Ziele verfolgen Sie dort?
Ciupka-Schön: Martin Niebuhr (Gründer von OCDLand), kam vor etwa 1 ½ Jahren mit der Idee auf mich zu, eine Gesundheitsapp zu programmieren. Es stellte sich schnell heraus, dass Martin selbst OCD-Betroffener ist und dann sagte ich zu ihm: „Es ist ja auch wichtig, das ganze professionell und mit therapeutischer Unterstützung aufzuziehen“.
Neben der Möglichkeit, dass man therapeutische Übungen mit dieser Gesundheits-App macht, haben wir sehr viel Zeit investiert und Mühe aufgebracht, um Texte zu schreiben. Und zwar Texte, die verständlich sind und trotzdem einer wissenschaftlichen Betrachtung standhalten können. Das ist etwas, was sehr viele Betroffene angesprochen hat, weil wir sehr viel Wert daraufgelegt haben, auf verständliche Art und Weise zu motivieren und Mut zu machen, die eigentlich entscheidenden Schritte zu gehen. Diese sind therapeutisch gesehen erst mal sehr einfach, sie werden von den Betroffenen aber häufig nicht gemacht. Deshalb ist die gesamte Therapiearbeit eine Motivationsarbeit, deswegen habe ich mein Buch auch „Das Mutmachbuch“ genannt. Und die Motivation und das Mut-machen, das setzt schon mit der Medienarbeit ein. Die Medienarbeit hat im Vorfeld, vor der Therapie als Mutmach-Instrument, eine ganz wichtige Rolle.
OCDLand richtet sich sowohl an Betroffene, als auch Psychotherapeut:innen
Sie schreiben auch Artikel für den Blog von OCDLand habe ich gesehen. Haben Sie dort bestimmte Themenschwerpunkte?
Ciupka-Schön: Wir haben das in der Anfangsphase so gemacht, und das setzen wir auch so fort, dass immer ein Betroffener einen Artikel schreibt und ihn von einem Profi, also einem Therapeuten gegenlesen, ergänzen und verbessern lässt. Umgekehrt, wenn ich als Therapeut einen Artikel schreibe, wird der auch von einem Betroffenen oder einer Betroffenen gegengelesen, der auf Dinge aufmerksam macht, für die wir als Therapeuten vielleicht nicht immer ganz sensibel sind, wie zum Beispiel die Selbststigmatisierung.
Es ist ganz wichtig, dass die Artikel, die wir schreiben, aus der Feder dieser beider Perspektiven kommen. Ich denke auf diese Art und Weise ist uns etwas gelungen, was sowohl Betroffene als auch die Kollegen anspricht. Die Themen, die wir besprochen haben, waren zum Beispiel: „Was ist eigentlich eine Verhaltenstherapie?“, oder auch welche Medikamente man einnehmen kann. Jetzt sind wir gerade in einer Phase, in der wir versuchen, die Spannbreite der verschiedenen Zwänge, die es gibt abzudecken.

©OCDLand
Abstrakte Aspekte von psychischen Erkrankungen zeigen
Betroffene, insbesondere Betroffene von OCD sprechen oft davon, dass viele Themen rund um psychische Erkrankungen öffentlich noch tabuisiert sind. Was würden Sie zu diesen Tabuthemen zählen?
Ciupka-Schön: Ich denke, dass das Tabu selbst ein sehr starkes Zwangsthema ist. Medien, gerade Fernsehmedien, berichten am liebsten über Themen, die man in bewegten Bildern darstellen kann. Ich stelle fest, dass jemand betroffenes den Zwang ganz anders darstellt als Journalisten, die nicht selbst betroffen sind. Nicht-betroffene Journalisten oder auch Künstler, die stellen bei Zwängen meistens irgendwelche Hände dar. Das sind dann entweder die waschenden Hände oder die kontrollierenden Hände – als Nicht-Eingeweihter, der eine Berichterstattung in dieser Form sieht, könnte den Eindruck bekommen, dass der Zwang irgendwie in den Händen steckt. Nach meiner Beobachtung ist es dagegen aber eher so, dass dreiviertel der Zwänge sich im Kopf abspielen und das kann man in bewegten Bildern kaum darstellen.
“Das Tabu an sich gehört zum Zwang”
Glauben Sie, dass Zwänge mit sichtbaren Zwangshandlungen, wie Waschzwänge medial mehr repräsentiert sind als mentale Zwänge, die sich auf gewalttätige oder sexuelle Zwänge beziehen? Weil sie eben nicht solche Tabuthemen beinhalten?
Ciupka-Schön: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das Tabu, also das Nicht-Zeigen-Wollen an sich, gehört zum Zwang. Waschen und etwas kontrollieren zu wollen, ist insofern vielleicht etwas leichter für Betroffene, da es etwas abbildet, das wir als Tugend verstehen. Hygiene, Sauberkeit, Ordnung, Sparsamkeit, Frömmigkeit bei religiösen Zwängen, sind alles Dinge, die Ziel einer guten Erziehung waren. Dass daraus etwas Schlechtes werden könnte, ahnt keiner.
Wenn jemand sagt „Ich wasche“ dann sagen die meisten anderen Menschen, wenn er das nicht weiter ausführt und sie kein genaues Bild vom exzessiven Ausmaß dieses Waschens bekommen, „Ja, der wäscht viel, das ist ein sauberer Mensch. Das ist doch ne tolle Sache“. Das ist, glaube ich bei Themen wie sexuelle oder aggressive Zwangsgedanken ein bisschen anders. Das löst häufig bei Leuten, die das gesagt bekommen, schnell die Idee aus, wenn jemand aggressive Zwangsgedanken hat, könnte er die am Ende wirklich umsetzen. Deswegen ist die Scheu hier besonders groß.
Vielleicht ist es für Nicht-Betroffene auch besser nachvollziehbar, weshalb jemand sich die Hände wäscht, als wenn jemand es vermeidet an einem Küchenmesser vorbeizugehen?
Ciupka-Schön: Ja, zumindest glaubt ein Zuschauer oder Zuhörer, er hätte das alles verstanden und er glaubt aggressive oder sexuelle Zwangsgedanken wären besonders unverständlich, weil das vielleicht am wenigsten mit dem eigenen Erleben am Hut hat. In Wirklichkeit gehört aber ein Verständnisschritt mehr dazu.
Eigenstigma überwinden – Wenn Betroffene sich an die Öffentlichkeit wenden
Was glauben Sie, wie wirkt sich das auf Betroffene von Zwangserkrankungen aus, dass diese Art von Zwangsthemen medial wenig repräsentiert sind? Wie wirkt sich das auf das Stigma und vor allem auch das Eigen-Stigma aus?
Ciupka-Schön: Ich habe gerade heute Morgen mit Prof. Rüsch gesprochen, der Stigma als Forschungsgebiet hat. Wir wollen tatsächlich eine Masterarbeit dazu haben, weil es bislang wohl nur wenig gesichertes wissenschaftliches Material dazu gibt, wie Stigmatisierung bei Zwangserkrankten funktioniert. Meine klinische Beobachtung ist, dass die Stigmatisierung eine von Betroffenen eher selbst gemacht Sache ist. Das heißt Betroffene einer Zwangsstörung glauben, dass sie von anderen Leuten sehr stark wegen ihrer Symptomatik verurteilt werden, das ist aber nicht meine Einschätzung. Ich glaube, dass Zwangsbetroffene in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit viel positiver sind, als sie das von sich selbst glauben. Das ist meine Einschätzung, aber das wird erstmal nochmal zu prüfen sein, ob diese Hypothese stimmt.
“Wenn ich mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und niemandem über meine besonderen Dinge etwas erzähle, dann kann ich auch nie eine gegenteilige Erfahrung machen.”
Ciupka-Schön: Natürlich sollte man jede Stigmatisierung, die von außen kommt, reduzieren. Als Therapeut arbeite ich aber eher an den Themen, wo Betroffene selbst beitragen können, um sich nicht in ihrem Selbstwert zu schmälern. Das passiert eben gerade durch das Versteckspiel, das sie betreiben. Wenn ich mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und niemandem über meine besonderen Dinge etwas erzähle, dann kann ich auch nie eine gegenteilige Erfahrung machen. Die gleichen Erfahrungen machen auch Psychotherapeuten. Die führen meist auch ein sehr zurückgezogenes Leben. Zum einen ist das gesetzlich auch so festgelegt, dass wir eine Schweigepflicht haben. Ich bin aber durchaus dafür, dass Therapeuten ihr therapeutisches Handeln einer großen Öffentlichkeit zugänglich machen sollten, weil das auch Hemmschwellen nehmen würde, sich frühzeitig therapeutische Hilfe zu suchen. Je früher man gegen unterschiedliche Probleme vorgeht, desto besser ist die Prognose.
Das Versteckspiel beenden
Glauben Sie, dass es deswegen sinnvoll wäre, wenn Betroffene sich mehr an die Öffentlichkeit wenden würden und aktiver nach außen hin über ihre Erkrankung sprechen würden?
Ciupka-Schön: Ja, ganz genau, das ist 30 Jahre meiner beruflichen Arbeit gewesen. Wenn ich Betroffene in Talkshows begleitet habe, konnten sie sich natürlich auch verfremden lassen. Sie haben zum Beispiel eine Perücke oder eine Brille aufgesetzt bekommen, damit man sie nicht erkennen konnte. Mir war es aber natürlich immer am liebsten, wenn ich Betroffene hatte, die eine sympathische Erscheinung hatten, gut sprechen konnten, ihre Zwangsstörung auch offen dargestellt haben und sich mit Klarnamen und ohne Verfremdung in einer Talkshow präsentiert haben. Das hat anderen Betroffenen auch immer Mut gemacht und ihnen letztendlich das Gefühl gegeben, dass sie mit ihrem Problem nicht allein sind.
Auch dieses Selbstverständnis, dass an ihrer Störung etwas Unheimliches oder etwas Abwertend-wertes ist, konnte sich dadurch, dass eine breite Öffentlichkeit davon erstmals erfahren hat und es auch spürbar war, dass diese erwartete Ablehnung gar nicht aufgetreten ist, lösen. Das ist eine Beobachtung, die ich immer wieder mache: die Betroffenen, die sich outen, stellen hinterher fest, dass diese Störung viel verbreiteter ist, als sie das vorher geahnt haben. Das Versteckspiel wird eben von allen geteilt und meiner Ansicht nach gilt es dieses Tabu zu durchbrechen.

©Unsplash
Verantwortung von Journalist:innen
Wie groß ist die Verantwortung von Journalist:innen Ihrer Meinung nach, Betroffenen eine Bühne zu geben?
Ciupka-Schön: Ich hätte mir damals wie heute gewünscht, dass ein bisschen mehr Aufwand betrieben wird, nicht nur die gut darstellbaren Zwänge zu repräsentieren. Ich denke, es ist immer einer Frage der Fantasie und man braucht ein weniger mehr Zeit und Idee, um auch das Abstrakte, was Zwänge im Kern ausmacht darzustellen. Dann ist es zum anderen wichtig, Minderheiten respektvoll darzustellen. Auch habe ich schon Einladungen zu Showformaten bekommen, wo das Leid von Betroffenen rein voyeuristisch konsumiert wurde. Ich kenne aber auch Beispiel, in denen man sehr verantwortungsvoll und respektvoll mit der Darstellung von Betroffenen umgegangen ist.
“Ich will ich nicht ganz ausschließen, dass wir in einer Welt leben, wo es auch geringschätzende und abwertende Menschen gibt, aber ich finde nicht, dass man denen das Feld überlassen sollte.”
Das passt auch gut zu meiner Frage, welche Gefahren es denn gibt, wenn man sich als Betroffene:r nach außen wendet. Was sind vielleicht auch Befürchtungen der Personen, was alles passieren könnte?
Ciupka-Schön: Ich war insgesamt glaube ich in 11 Talkshows, in die ich auch immer Betroffene mitgebracht habe. Ich habe so gut wie nie mitbekommen, dass hinterher negative Konsequenzen für die Betroffenen daraus erwachsen sind. Das ist sicherlich auch nicht allen Leuten möglich und hängt sehr davon ab, in welcher Umgebung sie leben. Von daher muss jeder Betroffene selbst entscheiden, ob das in der jeweiligen Position und gesellschaftlichen Rolle machbar ist.
Aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es eine Sache, die zur Zwangsstörung gehört. Nämlich, dass man die soziale Ächtung für größer hält als sie ist. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass, wenn die Angst vor der sozialen Ächtung durchbrochen wurde, die Leute durchaus freier gelebt haben. Wenn das Phänomen ihrer Zwangsstörung eine große öffentliche Aufmerksamkeit bekommen hat, hat es den Betroffenen selbst sehr gutgetan. Klar, ich will ich nicht ganz ausschließen, dass wir in einer Welt leben, wo es auch geringschätzende und abwertende Menschen gibt, aber ich finde nicht, dass man denen das Feld überlassen sollte.
“Es ist für Betroffene wichtig, frühzeitig den richtigen Weg zu finden. Dafür ist Journalismus sehr wichtig”
Wie können Journalist:innen und Therapeut:innen denn besser zusammenarbeiten? Wie könne sie Themen über die man sonst nicht spricht, in die Öffentlichkeit bringen?
Ciupka-Schön: Da kenne ich natürliche die Seite meiner Kollegen besser. Ich werde häufig ein wenig belächelt. „Naja der Burkhard ist da ein bisschen narzisstisch, der muss immer in die Medien gehen“. Ich gebe auch zu, das macht Spaß, aber ich glaube, dass obendrauf viel Zweck dahintersteckt. Ich glaube, es ist für Betroffene wichtig, frühzeitig den richtigen Weg zu finden. Dafür ist Journalismus sehr wichtig. Therapeuten haben eine Neigung zum Diskreten und zum Verborgenen und ich glaube, das teilen sie mit vielen Betroffenen. Ich glaube aber, dass das nicht unbedingt der seelischen Gesundheit förderlich ist.
Da wäre es dann auch wichtig, dass Therapeut:innen gegenüber Journalist:innen offener werden? Und, dass die journalistische Seite gleichermaßen auf Expert:innen aus der Psychologie zugeht?
Ciupka-Schön: Ja, ich denke, es geht auch in beiden Berufen um Kommunikation und das Interesse am Menschen. Von daher gibt es eigentlich zwischen Journalismus und Psychologen eine große Schnittmenge und Übereinstimmung in den Themen. Wenn es nicht gerade die Klatschpresse ist, hat man auch einen Ehrenkodex, das Gute im Menschen zu unterstützen. Auch da sehe ich durchaus eine Schnittmenge. Ich habe mich in meiner journalistischen Rolle bei der deutschen Gesellschaft für Zwangserkrankungen immer sehr wohlgefühlt. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich nur ein einziges meiner beruflichen Ideale verraten hätte. Im Gegenteil.
“Es geht uns alle nichts mehr an als das geistige Befinden.”
Vielleicht überträgt sich das auch unbewusst auf Medienschaffende. Also dass man Therapie und psychische Erkrankungen immer als etwas Privates ansieht, worüber sich keiner äußern möchte. Vielleicht sind viele Themen deshalb auch unterrepräsentiert?
Ciupka-Schön: Ich denke, es geht uns alle nichts mehr an als das geistige Befinden. Wenn ich als Beispiel einen amerikanischen Präsidenten nehmen, der auf Deutsch gesagt verrückt ist, dann kann das den Untergang der Welt bedeuten. Dass so jemand ein Amt ohne Gesundheitscheck annehmen kann, ist immer noch ein Rätsel für mich.
“Wenn wir sagen „Ne, das ist uns nicht gut genug“, dann berichten die trotzdem über dieses Thema”
Wie kann man Menschen abseits der „Mental-Health-Bubble“ erreichen? Also Menschen, die bisher keine Berührungspunkte mit solchen Themen hatten?
Ciupka-Schön: Ich weiß aus meiner bisherigen Erfahrung, dass wir uns damals nicht zu fein für Talkshows waren. Das war bei uns im Vorstand durchaus umstritten. Man wollte sich eher auf die seriöse und wissenschaftliche Berichterstattung konzentrieren. Der Besuch von Talkshows und anderen Unterhaltungsformaten wurde eher mit spitzen Fingern angefasst. Ich habe damals aber, denke ich, ein ganz großes Publikum erreichen können. Wir haben immer gemerkt, die großen Waschkörbe voller Post von Ratsuchenden, von Betroffenen, die schon eine therapeutische Odyssee hinter sich hatten und für die endlich deutlich wurde, was sie eigentlich haben und was für sie die nächsten Schritte einer zielführenden Behandlung sein könnten, kamen durch solche Massenmedien.
Früher waren es Talkshows, heute sind es Podcasts und YouTube-Videos, die von großen Massen der Menschen konsumiert werden. Wenn wir uns als Therapeuten mit solchen Medien auseinandersetzen, dann haben wir auch einen Einfluss darauf. Wenn wir sagen „Ne, das ist uns nicht gut genug“, dann berichten die trotzdem über dieses Thema, aber auf eine Art und Weise, die der Sache überhaupt nicht dienlich ist.
Psychische Erkrankungen normalisieren – eine Gradwanderung
Innerhalb der Psychologie wird manchmal auch darüber diskutiert, wie über psychische Erkrankungen berichtet werden soll. Die einen sind der Ansicht, es werde zu wenig über schwere Krankheitsverläufe oder „Extrem-Beispiele“ gesprochen. Es gibt zum Beispiel ein Interview mit dem Psychotherapeuten Manfred Lütz, der sagt, wir würden mehr über die Psychologie der Bäume, als über Schizophrenie sprechen. Andere finden, es sei wichtig, nicht zu viele Beispiele in der Berichterstattung herauszupicken, die für Sensation bei Leser:innen sorgen, um so mehr Identifikationspotential zu schaffen. Wie sehen Sie das?
Ciupka-Schön: Ich würde da kein Entweder-Oder draus machen. Der Kollege Manfred Lütz hat sicher recht. Er ist ärztlicher Direktor eines psychiatrischen Krankenhauses in Köln und erlebt natürlich tagtäglich, dass diese schweren Erkrankungen, obwohl sie allgegenwärtig sind, in der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen werden. Das geht so weit, dass kaum jemand sich in so eine Klinik traut. Dass Patienten, die dort behandelt werden, von ihren Freunden oder Nachbarn kaum besucht mal werden. Ich denke schon, dass man diesen psychiatrischen Kliniken den Stellenwert geben sollte, den sie tatsächlich haben, da sie auch wirklich ein stabilisierender und gesundheitserhaltender Faktor für unsere Gesellschaft sind. Man sollte da keine „No-Go-Area“ draus machen.
Ich denke, die andere Seite ist die, die ich auch immer mehr vertreten habe, dass man den Betroffenen vor allem Mut machen muss. Das kann ich besser erreichen, indem ich eher positive Seiten des Ganzen zeige. Ich denke, eine positive Prognose kann ich dadurch erreichen, indem ich sehr früh den Betroffenen erreiche und ihm sage: „Wenn du jetzt früh was tust, dann kannst du eine ganze Menge negative Dinge verhindern“. Ich weiß nicht, ob eine zu drastische Darstellung einer psychiatrischen Klinik, gerade die Vermeidung der ganzen Thematik unterstützen würde. Das sind aber erstmal Beobachtungen aus meinem Alltag, das kann wissenschaftlich gesehen auch ganz anders aussehen.
Psychische Erkrankungen mit einer Selbstverständlichkeit behandeln
Über welche Themen wünschen Sie in journalistischer Berichterstattung mehr zu lesen, wenn es um psychische Erkrankungen geht?
Ciupka-Schön: Ich denke es ist wichtig, dass es eben kein Tabu-Thema mehr ist in der Zukunft und dass es für uns eine Selbstverständlichkeit wird, dass, genauso wie wir bei einem Schnupfen zum Hausarzt gehen würden, wir für eine stressbedingte psychosomatische Störung, genauso die Hilfe brauchen, wie für das, wofür man sonst normale Medizin bekommt. Es gibt keine guten und keine schlechten Diagnosen. Es gibt keine gute und keine schlechte Behandlung. Das wäre das, was ich mir im Journalismus wünschen würde. Das hieße auch, dass man zum Beispiel die Depression, die mit 25% Prävalenz in der Bevölkerung die häufigste Krankheit überhaupt ist, und mit 4% Prävalenz in der Bevölkerung, ist auch die Zwangserkrankung eine der häufigsten Erkrankungen, im Journalismus mit einer gewissen Selbstverständlichkeit gehandhabt werden würde.
Brechen wir mehr mit Tabus?
Hat sich da in den vergangenen Jahren schon etwas dahingehend verändert? Können sie beobachten, dass mehr Tabus gebrochen werden?
Ciupka-Schön: Ich habe wie gesagt keine wissenschaftliche Antwort darauf. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich in diesen fünf Jahren von 1995 bis 2000 als Geschäftsführer der deutschen Gesellschaft für Zwangserkrankungen, allein 22 verschiedene Fernsehauftritte und Interviews bei verschiedenen Medienformaten gehabt habe und ich habe wirklich mit beobachten können, wie in dieser Zeit die Aufmerksamkeit in der Gesamtbevölkerung gestiegen ist und auch sehr viele Betroffene aus ihrem Schattendasein herausgefunden haben. Es hat damals 15-20 Jahre gebraucht, bis Betroffene einer Zwangserkrankung das erste Mal therapeutischen Kontakt gesucht haben. Ich denke diese Zahl, ist heute erheblich kürzer geworden. Man sieht heute in den niedergelassenen Praxen auch häufiger sehr junge Menschen, die hoffentlich auch sehr früh zielführende Behandlung bekommen.
“Es sollte eine realistische und eine sehr wertschätzende Darstellung sein.”
Abschließend, was würden sie Journalist:innen als Tipp mitgeben, wenn sie über Tabu-Themen berichten wollen?
Ciupka-Schön: Betroffene habe ich immer dann motivieren können, wenn ich sicherstellen konnte, dass es Wertschätzung gibt. Respekt und Wertschätzung in der Berichterstattung. Also, dass man als Betroffener, der interviewt wird, in seinen Bedürfnissen und seinem Leid gesehen wird. Ich glaube, dass es heute bei den privaten Medien die Tendenz dazu gibt, dass alles immer schnelllebiger sein muss und nicht viel kosten darf. In sehr schnelllebigen Formaten werden Betroffene unter Umständen verheizt.
Wenn man sich als Journalist mehr Zeit nehmen kann, ist eine ganzheitliche, wertschätzende Betrachtung, wo nicht nur die Störung, das Sensationelle und Ungewöhnliche gezeigt wird, möglich. Ungewöhnlich muss es zwar sein, sonst wird es auch niemanden interessieren. Insofern ist es schon wichtig, dass man etwas Interessantes darbietet, aber dabei nicht sensationslüsternd ist. Es sollte eine realistische und eine sehr wertschätzende Darstellung sein. Dann kann auch ein Betroffener, der sich für so etwas zur Verfügung stellt, hinterher nicht einfach nur sagen, er hat sich geopfert, sondern er kann auch aus einer Situation herausgehen und das Gefühl haben: „Ich habe etwas für mich selbst getan, ich habe das Versteckspiel beendet und das tut mir im Endeffekt selbst gut“.
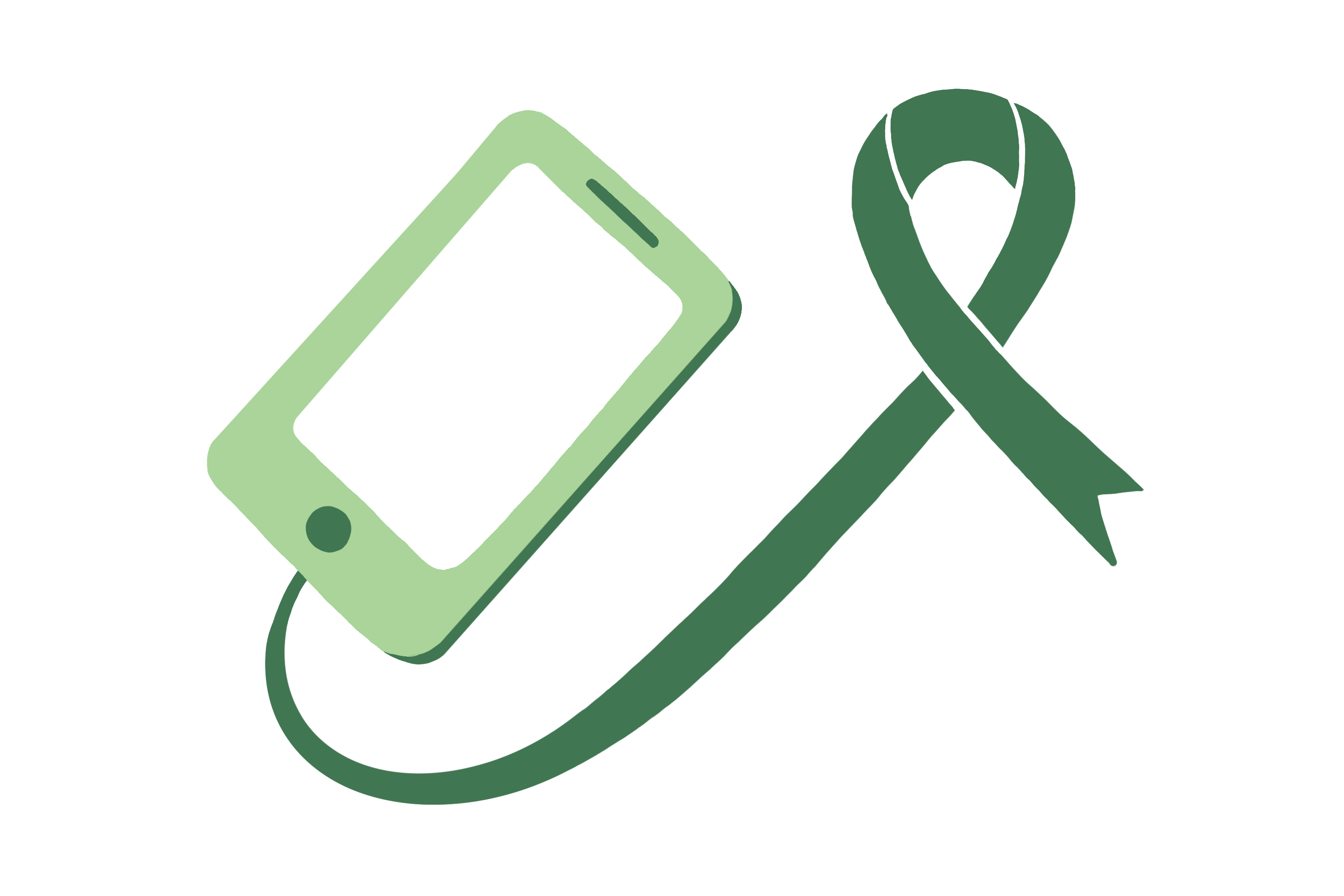




Ein wirklich gelungenes und interessantes Interview. Dankeschön