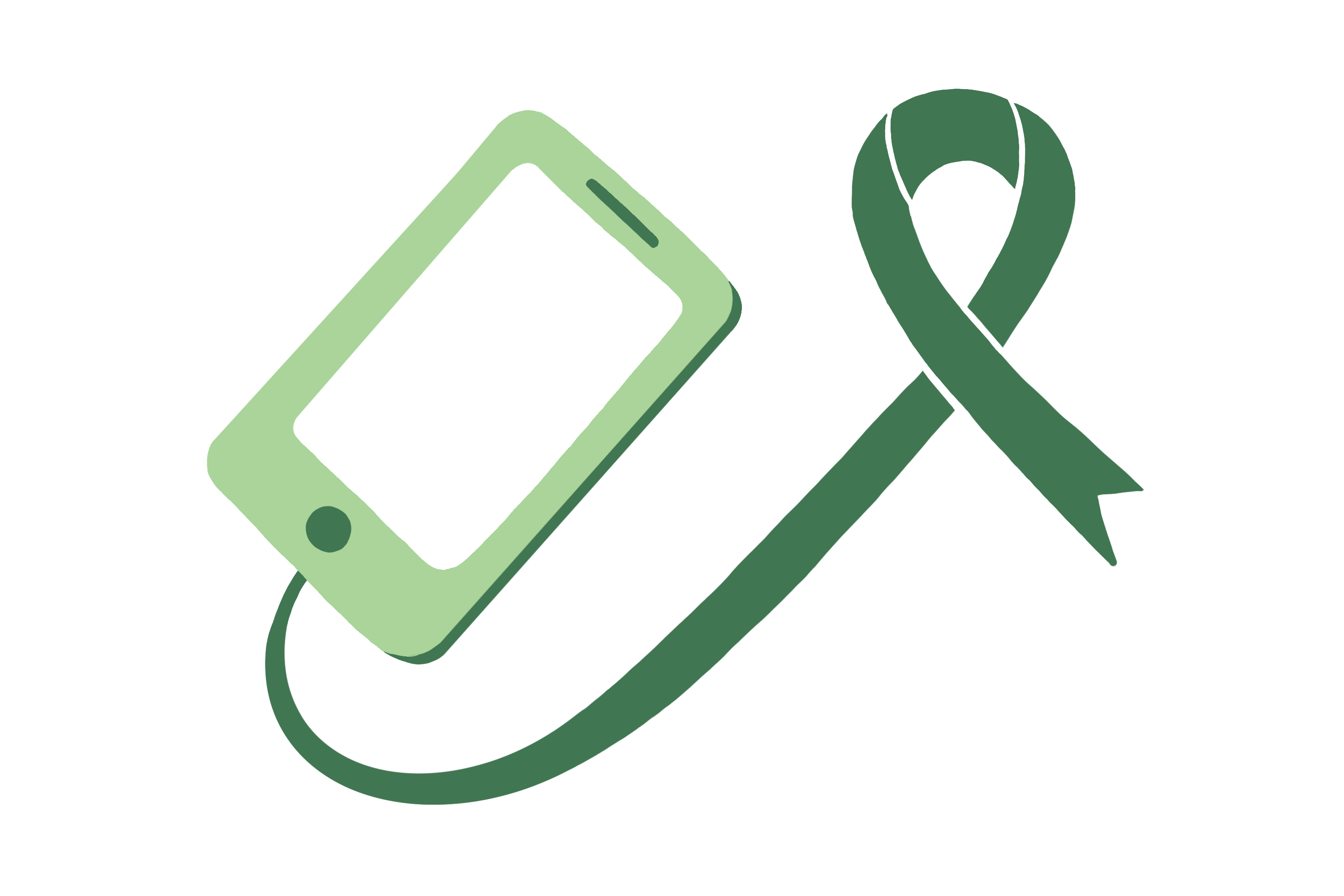Leinwand Therapeut:innen und Psychiater:innen praktizieren seit es bewegte Bilder gibt. Denn was viele nicht wissen, die Geschichte des Films und der modernen Psychotherapie haben gemeinsame Anfänge im frühen 20. Jahrhundert. Wie hat sich das Bild von Psychotherapie und Therapeut:innen im Laufe der Filmgeschichte verändert und wer sind Dr. Dippy, Dr. Wonderful und Dr. Evil?
Fans der amerikanischen Anwaltsserie Suits werden sich sicher an die Therapiesitzungen des leicht cholerischen und zutiefst unsicheren Charakters, Louis Litt erinnern. Dr. Stan Lipschitz versucht über die Staffeln der Serie hinweg seinen Patienten vor dessen aufbrausendem Temperament und den Konflikten, die dadurch mit Kolleg:innen der Kanzlei entstehen, zu bewahren. Schaut man sich den freundlichen kahlköpfigen Therapeuten mit der Brille und dem österreichischen Dialekt einmal genauer an, springt einem schnell eine gewisse Ähnlichkeit mit niemand geringerem als Sigmund Freud selbst, dem Gründervater der Psychoanalyse, entgegen.


Therapeut:innen gehören seit langem zum Ensemble verschiedener Film- und Seriencharaktere. Mal in Gestalt des freundlichen Helfers und Lebensberater, wie Dr. Lipschitz in Suits, mal als karierehungriger Egomane, wie Dr. Marvin in What about Bob? Sie verlieben sich in ihre Patient:inne, wie Dr. Eudora Fletcher in Zelig und verstoßen damit gegen die ethischen Grundsätze, ihres Berufsfelds. Psycholog:innen üben deshalb auch an der Darstellung von Therapeut:innen und Psychotherapie in Filmen und Serien Kritik. Haben Filme und Serien mit ihrer Darstellungsweise eine Art kulturellen Mythos um Psychotherapie geschaffen und was hat es damit auf sich?
Gemeinsame Anfänge im frühen 20. Jahrhundert
Tatsächlich sind die Filmgeschichte und die Geschichte der Psychiatrie enger miteinander verwoben, als man vermuten würde. Sigmund Freud und seine Werke „Traumdeutung“, „Studien über die Hysterie“ und „Das Ich und das Es“ bilden mitunter die Grundsteine der Psychoanalyse. Auch wenn seine Arbeit mittlerweile in vielen Teilen als widerlegt und überholt gilt, liegt in der Psychoanalyse nach Freud die Wiege der modernen Psychiatrie.
Doch das Ende des 19. Jahrhunderts war nicht nur die Geburtsstunde der Psychoanalyse, sondern auch die des bewegten Bildes. Schon in ersten Meilensteinen der Filmgeschichte tauchten auch Psychiater als Figuren auf, wie zum Beispiel im expressionistischem Stummfilm Das Kabinett des Dr. Caligari oder in Dr. Mabuse, der Spieler.
Traumdeutung und Traumfabrik
Viele Filmemacher:innen waren von Anfang an fasziniert von psychoanalytischen Konzepten. Der Hollywood Produzent Samuel Goldwyn versuchte 1925 sogar Sigmund Freud für die gemeinsame Arbeit an einem seiner Filmprojekte zu gewinnen. Freud, der der Kunst des Filmemachens sein Leben lang nicht viel abgewinnen konnte, lehnte Goldwyns Angebot jedoch ab. Das Hollywood auch „Traumfabrik“ bezeichnet wird, kommt nicht von ungefähr. Filmemacher:innen sahen in Filmen Parallelen zu Träumen in Freuds Schriften, bewegte Bilder als Möglichkeit, das Unbewusste durch metaphorische Bedeutungen zu zeigen. Begriffe aus der Psychoanalyse tauchten deshalb schon früh in filmischen Inszenierungen auf und trugen dazu bei, das Fachjargon von Freud und seinen Kollegen über die Jahre hinweg, an die breite Bevölkerung weiterzutragen. Vor diesem geschichtlichen Hintergrund lassen sich heute viele filmische Darstellungen von Psychotherapie und Therapeut:innen betrachten. Außerdem hat sich hieraus eine eigene Form der Filmanalyse entwickelt, die psychoanalytische Konzepte nutzt, um tiefere Bedeutungen eines Films offenzulegen.
Der zeit-gesellschaftliche Entstehungskontext eines Filmes ist in der Filmwissenschaft ein wichtiger Anhaltspunkt, um Darstellungsweisen und Narrative, die in einer Inszenierung verwendet werden, zu verstehen. Der Zeitgeist bestimmter Epochen ist deshalb auch mit ausschlaggebend dafür, wie Psychotherapie und das Personal in psychiatrischen Institutionen in Filmen dargestellt wird.
Dr. Dippy und die Furcht vor dem Unbekannten
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war man nicht nur fasziniert von den freudschen Schriften, sondern vor allem auf US-amerikanischem Boden auch skeptisch gegenüber der aus Europa „importierten“ Wissenschaft. Als Resultat dieser Skepsis entstanden filmische Portraits von Psychotherapeuten und Psychiatern mit wienerischem Dialekt (angelehnt an Sigmund Freuds österreichische Herkunft), die mit bizarren und sinnlosen Praktiken versuchen, Patient:innen zu heilen und dabei für Lacher beim Publikum sorgten. Der Psychologe Irving Schneider fasst diesen Typ des Film-Psychiaters unter dem Namen Dr. Dippy zusammen. Dieser Name geht zurück auf den schusseligen und nicht allzu intelligenten Psychiater aus Dr. Dippy’s Sanatorium (1906), den man umgangssprachlich wohl auch als Quacksalber bezeichnen könnte. Filmische Inszenierungen wie diese zweifelten die Kompetenz von Psychiater:innen an, und stellten infrage, ob psychotherapeutische Konzepte überhaupt notwendig und wirksam seien.
Dr. Wonderful – Glanzstunde der Psychotherapie im Film?
Der Psychologe Glenn Gabbard beschreibt die Mitte des 20. Jahrhunderts, als Beginn eines “golden Zeitalters” für die Psychotherapie im Film. In diesem Zeitraum entstanden einige Filme, die eine idealisierte Form von Psychotherapeut:innen zeigten. Diese taten sich durch ihre herausragenden Fähigkeiten Patient:innen zu heilen, hervor und wurden von Irving Schneider deshalb auch Dr. Wonderful getauft.
Dr. Wonderful ist nahezu allwissend und überschreitet für seine oder ihre Patient:innen jede Menge Grenzen. Er oder sie ist rund um die Uhr verfügbar, wird selbst zum Detektiv, um versteckte Traumata der Patient:innen aufzudecken und geht sogar romantische oder sexuelle Beziehungen zu Klient:innen ein, wie Dr. Benjamin in Lovesick (1989). Dr. Wonderfuls Therapie läuft häufig darauf hinaus, unterdrücke traumatische Erinnerungen hervorzuholen, die die Betroffenen mit kathartischer Wirkung vom Leid ihrer Erkrankung zu erlösen.
Filmischen Inszenierungen greifen dabei eine Annahme aus der Psychoanalyse auf, nach welcher psychische Erkrankungen durch traumatische Erinnerungen aus der Kindheit, ausgelöst werden. Um die Krankheit zu bewältigen, muss die verdrängte Erinnerung an das Trauma wieder hergestellt werden. Interessanterweise, hatte Freud das Konzept der kathartischen Heilung, schon vor der Jahrhundertwende verworfen. In Filmen taucht diese Vorstellung von Therapie jedoch weiterhin immer wieder auf. Vielleicht wegen des kathartischen Elements, das Filme ihrem Publikum bieten möchten?
Eine Lösung für jedes Problem
Der Zeitgeist der Entstehungsepoche der Dr. Wonderfuls war von den Nachwirkungen des 2. Weltkriegs geprägt. Viele Kriegsveteranen waren schwer traumatisiert, soziale Probleme, wie Alkoholismus, Rassismus, Homophobie und psychische Erkrankungen nahmen im öffentlichen Diskurs Raum ein. Auch Hollywood wandte sich diesen Fragen vermehrt zu. Die Dr. Wonderfuls der Filmindustrie traten dabei als Heilsbringer:innen für gesellschaftliche Probleme auf.
Dr. Wonderful muss jedoch nicht immer persönlich involviert in die Geschichte der Patient:innen sein. In Hitchcocks‘ Psycho erläutert ein rationaler, abgeklärte Therapeut am Ende, weshalb Norman Bates in den Kleidern seiner Mutter zum mordlustigen Monster wird. Therapeut:innen dienen dem Sinn und Zweck irrationales und böses Verhalten anderer Charaktere zu erklären und sind damit wichtiger Bestandteil des Horror- und Thriller-Genres. Die Therapie selbst kann auch lediglich den Zweck verfolgen, dem Publikum das Innenleben der Protagonist:innen näherzubringen. Den Therapeut:innen selbst kommt im Plot keine andere Funktion zu, als das zum Vorschein zu bringen und die innere Reise der Protagonist:innen in die Wege zu leiten.
Dr. Evil und die Anti-Psychiatrie-Bewegung
Unter dem Einfluss der Anti-Psychiatrie-Bewegung der 1960er Jahre entstanden einige filmische Portraits von Therapeut:innen, die Irving Schneider unter dem Begriff des Dr.Evils fasst. Die Anti-Psychiatrie Bewegung, zu deren Vertreter:innen unter anderem der Soziologe Erving Goffman gehörte, prangerten den repressiven Charakter psychiatrischer Institutionen an. Nach Auffassung der Vertreter:innen waren psychische Erkrankungen menschliche Reaktionen auf gesellschaftliche Missstände, die durch den Kapitalismus verursacht wurden. Psychiatrische Intuitionen damit ein Instrument des Systems, um gesellschaftlicher Norm aufrechtzuerhalten.
Diese Auffassung spiegelt sich in Werken wie Einer flog über das Kuckucksnest wider. Die grausame Schwester Ratched und ihr Gefolge machen den Freigeist McMurphy am Ende mittels Lobotomie zu einem willenlosen Zombie. Die Psychiatrie ist hier ein Ort des Grauens und der Entmenschlichung. Das Fachpersonal entspricht dem Archetyp des Dr. Evils, welcher seine Patient:innen für Experimente ausnutzt, versucht ihren Willen zu brechen und sie in der Psychiatrie gefangen hält. Der rebellische Zeitgeist der 1960er Jahre, der sich kritisch gegen Autoritäten wandte, erklärt in Teilen auch der riesige Erfolg, den Einer flog über das Kuckucksnest damals einbrachte.
Weibliche Therapeutinnen und der „Love-Cure“
Geschlechterstereotype in Filmen machen auch vor der Darstellung weiblicher Therapeutinnen nicht halt. Angefangen mit Ingrid Bergmans Performance der Dr. Peterson in Hitchcocks Spellbound, überschreiten Frauen in therapeutischen Rollen in Filmen häufig ethische Grenzen, indem sie sich in ihre männlichen Patienten verliebten. Das vorherrschende Narrativ ist dabei: Eine Frau kann ihre Probleme nur lösen, indem sie sich in einen Mann verliebt. Die Therapeutinnen sind häufig kränker als ihre eigentlichen Patienten. Aufopferungsvoll kämpft Dr. Peterson für ihren John Ballantyne und heilt ihn und sich selbst am Ende mit ihrer Liebe. Diese Darstellung weiblicher Therapeutinnen ist nicht nur ein Gespenst vergangener Zeiten. Auch in aktuellen Serien und Filmen taucht dieser Trope weiterhin auf. Zum Beispiel in der Anwaltsserie Suits, wo sich Dr. Paula Agard in ihren Patienten, den Protagonisten Harvey Specter verliebt. Nachdem sie ihm bei der Bewältigung eines Kindheitstraumata geholfen hat, geht sie eine Liebesbeziehung mit ihm ein.

Dieser „Love-Cure“, die Annahme, dass man psychische Erkrankungen mit Liebe und Zuwendung heilen können, ist in vielen filmischen Inszenierungen ein verbreitetes Narrativ. Besonders weibliche Therapeutinnen heilen mit der Kraft der Liebe, die am Ende über alle verdrängten Traumata siegt. Doch auch männlichen Therapeuten, wie Dr. Berger in Ordinary People oder Dr. McGuire in The Good Will Hunting, erreichen mittels persönlicher Zuwendung und Empathie, den Durchbruch für ihre Patient:innen.
Der Therapie-Mythos
Die Psychologen Krin und Glen Gabbard schreiben davon, dass Hollywood und die Filmindustrie dazu beigetragen haben, einen kulturellen Mythos, um Psychotherapie zu erschaffen. Psychoanalytische Vorgehensweisen dominieren noch immer Leinwand-Therapiesitzungen. Andere Verfahren, wie die kognitive Verhaltenstherapie, sind dagegen seltener in Filmen zu sehen. Dabei sind diese Verfahren mittlerweile in ihrer Wirksamkeit sogar besser erforscht als die Psychoanalyse und gehören zur gängigen Praxis. Begreift man Filme als Spiegel gesellschaftlicher Annahmen, könnte man folglich vermuten, dass ein Großteil der Bevölkerung die Psychoanalyse noch immer für ein weit verbreitetes Verfahren hält, mit dem alle psychischen Erkrankungen behandelt werden können.
Glen Gabbard vergleicht Psychotherapie in Filmen und Serien mit einer Form von Seelsorge, die wenig mit einer echten Therapie gemein hätten. Filmcharaktere lernen selten Bewältigungsstrategien, die sie in ihrem Alltag anwenden können, sondern erforschen mit ihren Therapeut:innen verdrängte Erinnerungen und ähnliches. Das liegt vor allem daran, dass sich das filmisch anschaulicher aufbereiten lässt. Würde man versuchen, eine echte Therapiesitzung zu verfilmen, wäre das Publikum schnell gelangweilt, so Gabbard.
Praktizieren Dr.Evil, Dr. Wonderful und Dr. Dippy noch immer in Filmen und Serien?
Die Art und Weise, wie Therapie und Psychotherapeut:innen in Filmen und Serien dargestellt werden, steht auch immer in Zusammenhang mit ihrem soziokulturellen Entstehungskontext. Welche Schlüsse kann man also auf das Stigma um psychische Erkrankungen und ihre Behandlung ziehen? Was bedeutet es für gesellschaftliche Vorstellungen von Psychotherapie, wenn in der aktuellen Netflix-Produktion Devil in Ohio (2022) eine Psychiaterin ihre junge Patientin bei sich zuhause einquartiert und ihre eigenen Kindheitstraumata auf sie projiziert? Oder wenn in der Thriller-Serie Wer hat Sara ermordet? (2021) ein grausamer Psychotherapeut an schizophrenen Patient:innen Elektroschocktherapien ohne Betäubung durchführt, die Foltermethoden gleichen, und mit modernen Therapieform nichts zu tun haben. Dr. Evil und Dr. Wonderful scheinen noch immer in Filmen und Serien zu praktizieren. Dazu kommen Therapeut:innen, wie Jean Holloway in Gypsy, die im Verlaufe der Handlung immer tiefer in ihre eigenen seelischen Probleme verstricken, Berufliches und Privates vermischen und heillos überarbeitet und ausgebrannt sind.
Der Berliner Psychologe Ion-George Anghelescu schreibt dazu, dass Psychotherapeut:innen für ihre eigene Praxis aus filmischen Darstellungen Schlüsse daraus ziehen können, mit welchen Erwartungen Patient:innen unter Umständen zu ihnen in die Therapie kommen. Die Forschungslage dazu, wie sich filmische Inszenierungen von Therapie auf die Einstellung von Rezipient:innen auswirkt, ist aktuell jedoch sehr dünn.
Filme und Serien als Sprachrohr für Kritik?
Die Psychiatriegeschichte ist in sich nicht frei von Widersprüchen und Kritik. Fatale Irrläufer, wie die Lobotomie, haben in der Vergangenheit Menschenleben gekostet. Unter Hitlers Naziregime wurden psychiatrische Institutionen zum ausführenden Komplizen der Euthanasie. Die bösartigen Dr. Evils hat es in der Geschichte durchaus gegeben. Auch Filme, die aus einer Anti-Psychiatrischen Perspektive heraus entstanden sind, haben, wie der Psychiater Wulff Rössler schreibt, dazu beigetragen, dass sich Psychiatrie fundamental gewandelt habe. Zwar waren Lobotomien und Elektroschocks ohne Betäubung zum Entstehungszeitpunkt von Einer flog über das Kuckucksnest längst nicht mehr Teil der psychiatrischen Praxis. Das Gefühl abgeschottet vom Rest der Gesellschaft zu sein und die Stigmatisierung als Patient:in in einer psychiatrischen Einrichtung vermutlich durchaus eine Erfahrung, die Betroffene zu dieser Zeit gemacht haben.
Auch heute gibt es Kritikpunkte an der Art und Weise, wie psychische Erkrankungen im Gesundheitssystem gehandhabt werden. Betroffene landen oft auf ewig langen Wartelisten bis sie schließlich eine Therapieplatz finden. Der Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzten, Jakob Maske, sprach 2021 davon, dass die Triage, also die Entscheidung darüber, wer bei der Behandlung priorisiert werde, mittlerweile auch in der Kinder-und Jugendpsychiatrie angewandt werden müsse. Auch schon vor Pandemie 2019 ergab eine Ver.di Umfrage, dass Beschäftigte in Psychiatrien mit Unterbesetzungen und Überlastungen kämpfen. In Filmen- und Serien kann sich Kritik an bestehenden Missständen im Gesundheitssystem niederschlagen und Spiegel dafür sein, was im Auge der Öffentlichkeit an psychiatrischen Institutionen verändert werden sollte.
Filmische Darstellung von Psychotherapie als kulturelle Artefakte
Michael Shortland, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der University of Oxford und Experte für Wissenschaftsgeschichte, sieht in filmischen Darstellungen von Psychotherapie und Psychiatrie, kulturelle Artefakte. Filme und Serien ermöglichen es, einen Eindruck davon zu bekommen, wie sich die Wahrnehmung der Psychiatrie in der Gesellschaft und auch die Einrichtungen selbst im Laufe der Zeit wandeln. Der Medien- und Filmwissenschaftler Hans Wulff schreibt in seiner Publikation Psychiatrie im Film davon, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Psychiatrie im Film ein Versuch wäre, Spuren des Allerweltswissens über den Gegenstand zu sichern und zu betrachten, welche narrative Funktion Krankheit und Psychiatrie in Inszenierungen zukommt.
Das muss folglich jedoch nicht bedeuten, dass der Beitrag, den filmische Inszenierungen zum Stigma um psychische Erkrankungen leisten, bei einer solchen Betrachtung außenvorgelassen werden müssen. Im Gegenteil. Vielleicht können Filme und Serien so auch etwas über die Entwicklung gesellschaftlicher Stigmata gegenüber Betroffenen psychischer Erkrankungen und deren sozio-kulturellen Hintergrund verraten.